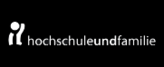ARISTOTELES. Nikomachische Ethik. | |
|---|---|
AUBENQUE, Pierre (2007): Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles. Hamburg: Meiner. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Aubenque gilt weltweit als einer der Kenner aristotelischen Denkens schlechthin, speziell des Klugheitsbegriffes bei Aristoteles. |
DEWEY, John (1934): Art as experience. London: Allan & Unwin. Ch. 3: Having an experience. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Erfahrung wird als ästhetisch charakterisiert, insofern sie sinnlich und spürend zugleich ist. Dewey definiert Erfahrung als bedeutsam, wenn sie Spuren hinterlässt, nicht bloßes Erlebnis ist. |
DEWEY, John (1929): The Quest for Certainty. A Study on the Relation of Knowledge and Action. New York: Milton, Balch & Co. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Dewey arbeitet die Identität von knowing and doing – in Abgrenzung zur Statik des knowledge – heraus. |
HEIDEGGER, Martin (1927): Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Hammer und Nagel – das von Polanyi bemühte Beispiel findet sich bereits bei Heidegger. |
MERLEAU-PONTY, Maurice (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: deGruyter. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Dieses Werk hat Michael Polanyi erkennbar stark beeinflusst. |
RYLE, Gilbert (1949): The Concept of Mind. London: Hutchinson. (Der Begriff des Geistes. Aus dem Englischen übers. v. Kurt Baier. Stuttgart: Reclam, 1969.) | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Berühmter Flankenangriff auf das Konzept „handlungssteuernder Kognitionen“ und „handlungssteuernden Wissens“. |
KEMMERLING, Andreas (1975): Gilbert Ryle. Können und Wissen. In: Speck, Josef (Hrsg.): Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Gegenwart III. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 126-166. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Eine inhaltlich und stilistisch glänzende Kurzdarstellung der Position Ryles zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissen und Können. |
NEUWEG, Georg Hans (2000): Können und Wissen. Eine alltagssprachphilosophische Verhältnisbestimmung. In: Neuweg, Georg Hans (Hrsg.): Wissen – Können – Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen. Innsbruck, Wien, München: Studien-Verl., S. 65-82. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Der Beitrag setzt sich vor dem Hintergrund der analytischen Handlungstheorie kritisch mit der mentalistischen Psychologie auseinander und begründet den „tacit knowing approach“ vor allem wissenschaftstheoretisch. |
WITTGENSTEIN, Ludwig (1953/2001). Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Wittgensteins Werk enthält zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Theorie des impliziten Wissens, vor allem in der Analyse der Frage, was es heißt, einer Regel zu folgen, und im Konzept der Familienähnlichkeit. |
GEBAUER, Gunter: Wittgensteins anthropologisches Denken. München: Beck Verlag: 2009
| |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | Wissenskonzepte hängen mit Theorien über die Körper-Geist-Dimension menschlicher Existenz zusammen. Gebauer gräbt diese Grundlagen in Wittgensteins Philosophie aus und erklärt somit die leibliche und kognitive Dimension des Wissens.
|
SCHNEIDER, Hans J. (1993): Die Situiertheit des Denkens, Wissens und Sprechens im Handeln. Perspektiven der Spätphilosophie Wittgensteins. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 41 (1993) 4, S. 727-739. | |
Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. | In jeder Hinsicht lesenswerte Annäherung an das Konzept des impliziten Wissens über den späten Wittgenstein. |
ARISTOTELES. Nikomachische Ethik. | Im Konzept der phronesis klingen wichtige Aspekte dessen bereits an, was wir heute unter dem Begriff des impliziten Wissens verhandeln. |
AUBENQUE, Pierre (2007): Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles. Hamburg: Meiner. | Aubenque gilt weltweit als einer der Kenner aristotelischen Denkens schlechthin, speziell des Klugheitsbegriffes bei Aristoteles. |
DEWEY, John (1934): Art as experience. London: Allan & Unwin. Ch. 3: Having an experience. | Erfahrung wird als ästhetisch charakterisiert, insofern sie sinnlich und spürend zugleich ist. Dewey definiert Erfahrung als bedeutsam, wenn sie Spuren hinterlässt, nicht bloßes Erlebnis ist. |
DEWEY, John (1929): The Quest for Certainty. A Study on the Relation of Knowledge and Action. New York: Milton, Balch & Co. | Dewey arbeitet die Identität von knowing and doing – in Abgrenzung zur Statik des knowledge – heraus. |
HEIDEGGER, Martin (1927): Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer. | Hammer und Nagel – das von Polanyi bemühte Beispiel findet sich bereits bei Heidegger. |
MERLEAU-PONTY, Maurice (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: deGruyter. | Dieses Werk hat Michael Polanyi erkennbar stark beeinflusst. |
RYLE, Gilbert (1949): The Concept of Mind. London: Hutchinson. (Der Begriff des Geistes. Aus dem Englischen übers. v. Kurt Baier. Stuttgart: Reclam, 1969.) | Berühmter Flankenangriff auf das Konzept „handlungssteuernder Kognitionen“ und „handlungssteuernden Wissens“. |
KEMMERLING, Andreas (1975): Gilbert Ryle. Können und Wissen. In: Speck, Josef (Hrsg.): Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Gegenwart III. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 126-166. | Eine inhaltlich und stilistisch glänzende Kurzdarstellung der Position Ryles zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissen und Können. |
NEUWEG, Georg Hans (2000): Können und Wissen. Eine alltagssprachphilosophische Verhältnisbestimmung. In: Neuweg, Georg Hans (Hrsg.): Wissen – Können – Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen. Innsbruck, Wien, München: Studien-Verl., S. 65-82. | Der Beitrag setzt sich vor dem Hintergrund der analytischen Handlungstheorie kritisch mit der mentalistischen Psychologie auseinander und begründet den „tacit knowing approach“ vor allem wissenschaftstheoretisch. |
WITTGENSTEIN, Ludwig (1953/2001). Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. | Wittgensteins Werk enthält zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Theorie des impliziten Wissens, vor allem in der Analyse der Frage, was es heißt, einer Regel zu folgen, und im Konzept der Familienähnlichkeit. |
GEBAUER, Gunter: Wittgensteins anthropologisches Denken. München: Beck Verlag: 2009
| Wissenskonzepte hängen mit Theorien über die Körper-Geist-Dimension menschlicher Existenz zusammen. Gebauer gräbt diese Grundlagen in Wittgensteins Philosophie aus und erklärt somit die leibliche und kognitive Dimension des Wissens.
|
SCHNEIDER, Hans J. (1993): Die Situiertheit des Denkens, Wissens und Sprechens im Handeln. Perspektiven der Spätphilosophie Wittgensteins. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 41 (1993) 4, S. 727-739. | In jeder Hinsicht lesenswerte Annäherung an das Konzept des impliziten Wissens über den späten Wittgenstein. |
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite