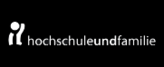Das große Taumeln
Der Angriffskrieg Russlands erschüttert Europa. Man hätte es besser wissen können. Viele Jahre haben wir Wohlstand mit Demokratie verwechselt und hatten kein Problem mit illiberalen Politikern. Nun erfahren wir schmerzhaft, dass es so nicht weitergehen kann. Ein Essay.
Fossiles Finale
Putins Krieg hat es endgültig klargemacht: Wir müssen raus aus Öl und Gas. Jetzt. Aber wie schaffen wir das? Und wie schnell?


Besser wird's nicht
Ob Corona, Ukraine-Krieg oder Inflation: Langsam zweifeln wir an unserer Sorglosigkeit und der Gewissheit, dass die Welt, in der wir leben, eine immer bessere wird. Aber wenn es nicht mehr bergauf geht, wohin geht es dann?
Schleim und Empörung
Es gehört zu den Grundfertigkeiten des postheroischen Politikers, der postheroischen Politikerin in Österreich, möglichst nichts Bemerkenswertes zu sagen, nichts, was in Erinnerung bleiben und später einmal gegen einen verwendet werden könnt e. Also man soll sich nur ja nicht bei einer pointierten Formulierung oder gar bei der Wahrheit ertappen lassen. So lebt’s sich legislaturperiodenlang ruhig und angenehm.
Einen gewaltigen Lapsus in Sachen Wahrheits- und Pointenvermeidung hat sich im Frühjahr dieses Jahres Werner Kogler, Österreichs Vizekanzler, geleistet. In der „Zeit im Bild“ hat Kogler am 7. März am Beginn des Ukraine-Krieges die (vorige) Bundesregierung und die Wirtschaftskammer scharf kritisiert – man habe, so Kogler, Putin einen roten Teppich ausgerollt, einen „roten Teppich mit Schleimspur“.
Mein Gott: Mit dem Kogler ist es durchgegangen! Das ist ja – unverzeihlich – glänzend formuliert, und der Mann hat (noch schlimmer) sogar recht. Über Jahre hat man Putin in Österreich den roten Teppich ausgerollt und auf dem Teppich sind die Schleimspuren noch sichtbar – peinliche Flecken, Spuren der Anbiederung.
Die grausliche Schleimspur ist eine unheimliche Erinnerungsspur. Es braucht keine sonderliche Archivrecherche: Österreichs Politik hat Wladimir Putin über Jahre hofiert, mit und ohne Ohrring-Geschenke, man hat rinks wie lechts den Autokraten über Jahrzehnte gewähren lassen – bei der Abschaffung der Pressefreiheit, bei der Annexion der Krim, bei der Bezeichnung der Ukraine als verfehlten Staat usw. usf. Man hat die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl ausgebaut und damit Putin und die Seinen zum Krieg, dem schlimmsten Verbrechen, nachgerade animiert. Der Putinismus, der im Krieg mündete, ist das Ungeheuer, das die österreichische Politik miterzeugt hat.
In einem kleinen, auch heute noch lesenswerten Aufsatz („Über das Unheimliche“) hat Sigmund Freud vor mehr als hundert Jahren auf die eigentümliche Qualität des Unheimlichen hingewiesen. Das Un-Heimliche ist das Gegenteil des Heimeligen und des Heimlichen im Wortsinn: Das, was möglichst heimlich bleiben sollte, kehrt plötzlich wieder, wird un-heimlich. Wird die Aufhebung des Heimlichen öffentlich, erzeugt sie Scham.
Die Reaktion auf die Wiederkehr des Verdrängten? Sie ist eine doppelt empörte: Man ist zunächst empört über den Boten Kogler, der die Sache in Erinnerung gerufen hat und der mit seinem glänzenden Bild vom Teppich und den Spuren darauf gegen den Konsens der Nullrhetorik (siehe oben) verstoßen hat. Die zweite Reaktion ist ebenfalls Empörung, eine ebenso lautstarke wie scheinhafte Empörung, die von Scham und Schuld entlasten soll. Man empört sich nun, da alles zu spät ist, über „den Krieg und seinen Schrecken“, um die Schleimspuren zu verwischen und die Scham zu kompensieren. Bundeskanzler Nehammer reist in einer sinnlosen Desperadoaktion nach Moskau, um sich ein moralisches Fleißzetterl abzuholen, und man hält sich an Künstlerinnen und Sportler. Man fordert in offenen Briefen „vehement“ „öffentliche Stellungnahmen“ ein, stimmen die Aufgeforderten nicht sogleich ein, kritisieren die Haltungslosen deren mangelnde „Haltung“ (und entlassen sie kurzerhand). So verwischt man preisgünstig die Schleimspuren.
Aber eben auch nicht ganz: Dass Kogl er darauf aufmerksam gemacht und das Verdrängte pointiert zu Bewusstsein gebracht hat, ist im politischen Juste Milieu Österreichs ein Skandal. Wir sind ihm dankbar dafür!

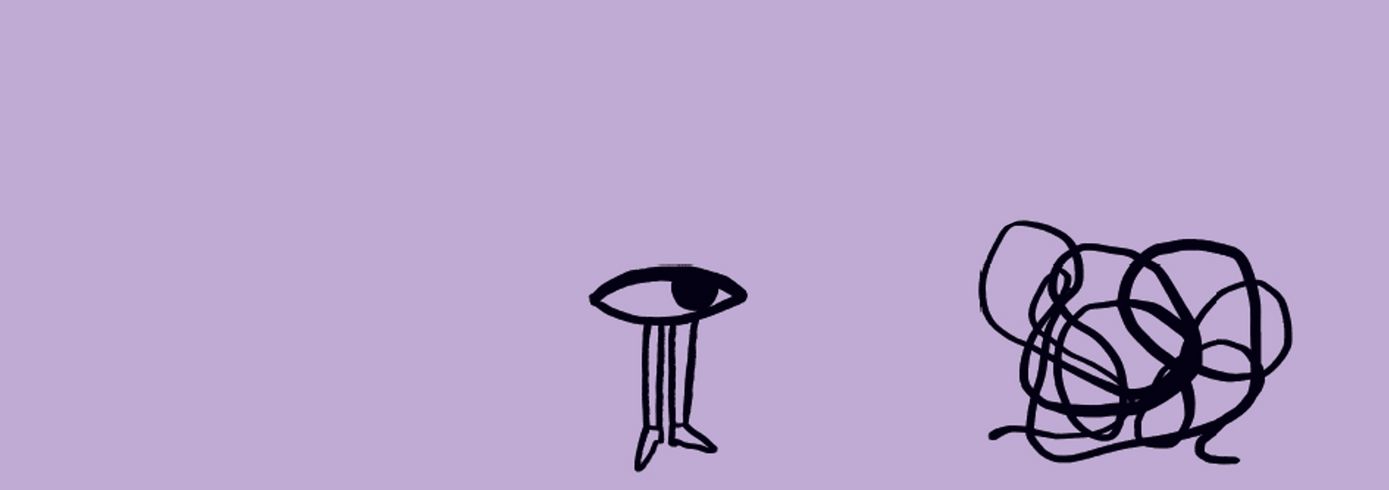
Dürfen wir noch Pelmeni essen?
Seit dem Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine im Februar hören wir vermehrt Berichte über Geschäfte, die russische Produkte wie Wodka und Pelmeni-Teigtaschen aus dem Sortiment nehmen, russische Kunstschaff ende, die ausgeladen werden und ihre Anstellung verlieren, und Cafés und Restaurants, die russische Gäste nicht mehr bedienen wollen. McDonald’s und andere Unternehmen ziehen sich ganz aus Russland zurück. Diese Handlungen sollen als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine verstanden werden, als Kritik am russischen Regime, und sie sollen die Ukraine durch Schwächung der russischen Wirtschaft unterstützen. Auch wenn die Antwort auf die Frage, wer Aggressor und wer Opfer in der jetzigen Situation wenig zweideutig ist, können und müssen wir erörtern, ob solche Solidaritätsbekundungen und wirtschaftlichen Maßnahmen vertretbar und moralisch gerechtfertigt sind.
In seinem berühmten Aufsatz „Politik als Beruf“ (1919) unterschied Max Weber zwischen zwei unterschiedlichen Standpunkten, von denen man ethisch orientierte Handlungen betrachten kann: dem der Gesinnungsethik und dem der Verantwortungsethik. Der Gesinnungsethiker handelt nach Maximen wie Kants kategorischem Imperativ oder dem liberalen Verbot, grundlegende Rechte von Menschen zu verletzen. Der Verantwortungsethiker schaut auf die Folgen einer Handlung und bewertet sie als moralisch gerechtfertigt, solange sie per Saldo das Gute in der Welt mehren.
Schon von einem gesinnungsethischen Standpunkt sind viele der Boykottmaßnahmen moralisch zumindest problematisch. Der Kern von Kants Imperativ ist die Ansicht, eine Handlung müsse generalisierbar sein, um als moralisch vertretbar zu gelten. Wir sollten also russische Waren oder Künstler nur dann boykottieren, wenn wir auch bereit wären, Vergleichbares in ähnlichen Konflikten zu tun. Das erscheint allerdings wenig ratsam. In der Welt toben zahlreiche Konflikte, und auch wenn uns die Ukraine näher erscheint, ist es nicht gerechtfertigt, hier mit zweierlei Maß zu messen. Zudem ist wahrscheinlich, dass Rechte der Beteiligten verletzt werden, wie z.B eigen das Recht, nicht aufgrund bestimmter Merkmale wie Muttersprache, Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit diskriminiert zu werden.
Eine Schwierigkeit mit der verantwortungsethischen Bewertung ist die genaue Vorhersage der Folgen der Handlung, insbesondere, wenn man sinnvollerweise verlangt, alle Folgen zu berücksichtigen. Was aber klar ist, ist, dass die tatsächlichen Folgen nur selten mit den intendierten Folgen übereinstimmen. Nur weil bestimmt e Maßnahmen das russische Regime schwächen sollen, heißt das nicht, dass sie es auch tun. Vor allem kann es auch eine große Anzahl von Leidtragenden geben, die mit der russischen Politik wenig oder gar nichts zu tun haben. Als Beispiele mögen die Angestellten der russischen McDonald’s-Filialen dienen, die nun ihren Job verlieren, die Zulieferer und Aktionäre von Mc-Donald’s oder die Konsumenten russischer Produkte bei uns.
Natürlich folgt aus Gesagtem nicht, dass es nicht auch sinnvolle Maßnahmen geben kann. Wenn etwa die Auslandsvermögen russischer Oligarchen eingefroren werden, um zu erreichen, dass sie Druck auf die Regierung ausüben, die Kampfhandlungen einzustellen, kann dies durchaus vertretbar sein. In vielen Fällen scheinen sie aber ihr Ziel zu verfehlen und vor allem unbeteiligte Russen und hiesige Konsumenten zu treffen. In solchen Fällen, so wohlintendiert die Maßnahme auch sein mag, müssen von verschiedenen ethischen Standpunkten aus berechtigte Zweifel angemeldet werden.
Kunst für die Technik und Technik für die Kunst
Im Rahmen des LIT-Calls präsentieren Forscher*innen der JKU insgesamt neun Projekte bei der Ars Electronica: Über allzu devote Technik, Musikstücke, die andere verschlucken, und die Frage „Können Handys Kunst genießen?“


Die unendliche Geschichte von der unendlichen Suche nach dem Planeten B in den unendlichen Weiten des Weltalls und auf der Erde
Das Ars Electronica Festival am JKU Campus Linz steht in diesem Jahr unter dem Motto „Welcome to Planet B“. Irgendwo da draußen muss es ihn doch geben. Wo genau er sich befindet, weiß man noch nicht. Wie man dort jemals hinkommen könnte, ist auch noch nicht klar. Doch der Blick über den Planeten A hinaus eröffnet neue Perspektiven auf die Erde selbst.
Die Bohne der guten Hoffnung
Soja spielte eine Schlüsselrolle in der Globalisierung, nährte die Gier nach Fleisch und wurde zum Sinnbild für Umweltsünden. Nun soll die Bohne die Welt retten. Wie viel Kraft für einen Systemwechsel steckt in ihr?


Nicht von gestern
Viele Menschen halten die Tuberkulose für eine Krankheit, die der Vergangenheit angehört. Dabei erkranken jährlich nach
wie vor mehr als zehn Millionen Menschen weltweit daran, für 1,5 Millionen Menschen endet sie mit dem Tod. Sie auszublenden, kann gefährlich sein. Wie schnell die Fallzahlen wieder steigen können, zeigt sich aktuell in der Ukraine.
Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Für mich heißt träumen, ohne Grenzen zu denken. Ohne Einschränkungen der physischen Welt die Gedanken frei zu lassen. Ungezügeltes Denken, Kreativität und Fantasie sind oft auch Wissenschaft in ihrer reinsten Form. Statt „more of the same“ entsteht dann „something completly different“.
Dieses völlig Neue ist es, was die Welt immer und immer wieder einen Schritt nach vorne bringt. Das Brechen von Normen, von gelernten Mustern ist dafür genauso Voraussetzung wie die Freude am Neuen. Ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, auf Flugreisen zu verzichten. Gänzlich. Kurz später habe ich mich dafür entschieden, weniger und weniger mit dem Auto zu fahren. Das ist am Anfang nicht einfach. Weil es gegen gelernte Mechanismen geht. Heute fehlt mir und meiner Familie nichts. Im Gegenteil, wir lieben diese neuen Erlebnisse. Dinge, die wir früher wenig beachtet haben, haben eine neue Qualität bekommen. Für mich ist es eine persönliche Entscheidung, aus dem Druck der „Fast Fashion“ auszusteigen. Nicht jeden Winter muss eine neue Jacke her – produziert in Südostasien unter indiskutablen Arbeitsbedingungen, auf Containerschiffen um die halbe Welt gekarrt, damit sie dann zehn Monate später farblich nicht mehr dem „Trend“ entspricht. Neue Kleidung muss für mich unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden, am besten aus Naturfasern. Die Wissenschaft zeigt uns, dass diese Träume richtig und möglich sind. Unsere Gewohnheiten machen den Umstieg schwer. Aber nur so lange, so lange nicht neue, gerechtere Gewohnheiten da sind.
Wenn ich heute über den JKU Campus gehe, dann sehe ich hier Gebäude verschiedenster Baustile – vom Schloss über das Keplergebäude, den TNF-Turm bis zur Kepler Hall. Unterschiedliche Heiztechniken, unterschiedliche Energieklassen. Wenn ich dann träume, dann träume ich von einer klimaneutralen, energieautarken Universität. Wo wir auf Dächern Sonnenstrom machen und mit erneuerbaren Energieformen heizen. Wo wir eine Universität nicht in der Natur, sondern mit der Natur haben. Das ist mein Traum einer „neuen Normalität“.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal haben wir mit Maria Buchmayr, Nachhaltigkeitsbeauftragte der JKU, gesprochen.


Das Ortsübliche ist nie das Mögliche!
NORBERT TRAWÖGER findet, dass wir uns jenseits des Gewohnten mehr für uns anstrengen sollten.
Das Leben ist schön, macht aber viel Arbeit
Das Leben ist schön, macht aber viel Arbeit H inter meinem Rücken bin ich zu einem eifrigen Menschen geworden, „udaungs“, wie meine Mühlviertler Ahnen gesagt hätten. Im Vergleich zu ihrem existenziell notwendigen Fleiß ist meine Emsigkeit natürlich ein Witz. Auf dem Sterbebett hatte die Großmutter meine Hand in die ihre genommen und gestreichelt, sie fuhr überrascht über die Schwielen. „Du bist ja doch eine für die Arbeit!“, sagte sie, und ich wagte nicht zu bekennen, dass die Hornhaut bloß vom Freizeitvergnügen in der Kletterhalle stammte.
Heute leistet mir die Sporthaut gute Dienste, ich kann die Gemüsebeete umstechen, ohne Blasen zu bekommen, ich schaufle reichlich Kompost in die Scheibtruhe, ich schraube ohne Handschuhe einen windschiefen Zaun zusammen, damit mir die Nachbarhunde nicht die Welpin sekkieren. Auch die Fußmaschine läuft rund, damit lässt es sich den ganzen Tag durch das Tote Gebirge stapfen. Was ich nicht leisten kann: 40 Stunden arbeiten. Ich schaffe mal 20, mal 60 in der Woche, selten 12 an einem Tag, aber einem Betrieb, einem Menschen, einer Sache genau 40 Stunden zu dienen, dafür ist der Geist nicht willig und das Sitzfleisch zu schwach. Selbstständige Arbeit kann auch recht unbequem sein, aber darüber zu jammern ist ungefähr so zielführend wie die Klage, dass es doch recht steil zum Großen Priel hinaufgehe.
Damit wir uns recht verstehen: Das hier wird nicht das verwöhnte Plädoyer einer verwöhnten Frau, sich doch bitte auch ein freies Erwerbsleben zu gönnen. Nichts wäre zynischer angesichts Hunderttausender Arbeitssuchender, angesichts Zehntausender in eine ausbeuterische Scheinselbstständigkeit Gezwungener oder angesichts der Überforderung von Pflegekräften, Lehrer*innen oder Putzfrauen. Es ist übrigens nicht deren Leistung, die sich laut neoliberalen Politfunktionär*innen wieder lohnen soll, sondern die „Arbeit“ jener, die hauptberuflich die Notstandshilfe kürzen und Arbeitslose demütigen. Dabei müsste in einer halbwegs fairen Gesellschaft das Geld ja wie ein warmer Mairegen auf alle herabregnen, die uns die Kinder erziehen und die Eltern pflegen und die Regale vollräumen. Das ist nicht das Plädoyer für ein Recht auf die Faulheit für Privilegierte. Die Steuerflüchtlinge und Scheinrechnungssteller*innen – und da sind wir uns einig, oder? – sind es ja, die in unserer sozialen Hängematte schmarotzen.
Das hier ist eine Brandrede gegen die fahrlässige Verschwendung von Lebenszeit – von eigener, und noch schlimmer: von der Lebenszeit der Mitmenschen. Wer gerne 60 Wochenstunden für ein Unternehmen oder eine Idee brennt, ist beneidens- und lobenswert. Wer aber ausbrennt, sind jene, die keinen tieferen Sinn in ihren Aufgaben sehen, oder die sie nicht sinnvoll ausführen können. Ein Burnout droht jenen, die unter gewaltigem Druck stehen, aber nicht von der Stelle dürfen – in der anachronistischen Benzinwelt steht der Begriff „Burnout“ für die dumme Übung, im Stand den Motor so hochzujagen, dass die Reifen stehend in Rauch aufgehen. Das Bild eignet sich zum Vergleich.
In diesem Sinn: Runter von der Bremse! Lasst uns hackeln! Verausgaben wir uns! Gibt es Besseres, als sich in eine Aufgabe zu vertiefen und rundum alles zu vergessen? Es gibt Millionen von euch da draußen, die bessere Hundezäune bauen, die kühnere Bergtouren wagen, die gescheitere Texte schreiben als ich – und Milliarden, die mit Freude und Talent pflegen, reinigen, konstruieren, lehren. Dieses ewige Maulen über die Faulen, ich mag es nicht mehr hören. Die paar Lumpis tragen wir mit unserer Tüchtigkeit doch locker mit, genauso wie wir mit Stolz alle unterstützen sollen, die aus guten und schlechten Gründen nicht hackeln und tschinäullen können. Es braucht keinen himmlischen Vater, der seine Vögelchen nährt, obwohl sie nicht säen und ernten (Pardon, aber hier irrte Jesus übrigens, denn ohne Tannenhäher keine Zirbe!). Ich mag nur nicht mehr jene schmerzbefreiten Arbeitgeber mittragen, die aus kaltem Effizienzdenken ihre Mitarbeiter*innen in monatelange Krankenstände treiben. Eine dümmere Vergeudung will mir nicht einfallen.
Wer am Stahlkocher schwitzt, soll weiter gut bezahlt werden, wer unsere Großmütter aus dem Bett hebt, sowieso. Und wir Büro-Ponys sollten unsere Leidenschaften nicht für Hobby und Pension aufsparen. Ist es nicht eine gewaltige Verschwendung, was wir da in der Arbeitswelt anstellen, dieses sehnsüchtige Warten auf Wochenende, Urlaub, Pension? Bis dahin erledigen wir das Aufgetragene so, wie man uns früher zum Mathematiklernen vergattert hat, indem wir ein Micky-Maus- ins HÜ-Heft klemmen und heimlich lesen, damit die Mama eine Ruh’ gibt. Der Begriff „Boreout“ ist mittlerweile fast so bekannt wie sein vermeintliches Gegenstück „Burnout“: Die Betroffenen überkommt das beklemmende Gefühl, schon zu viel Lebenszeit sinnlos in leere Abläufe investiert zu haben. Starre Konstrukte zermürben. Leider löst der Trend zum Home Office das Problem auch nicht automatisch – vom Verschmelzen von Arbeit und Freizeit kann ich lange Lieder singen.
Wir verkaufen einen schönen Teil unseres Daseins. Ich bin gewiss die Letzte, die eine schnelle Lösung für die Befreiung aus Hierarchien und für den Weg aus den Sackgassen der Arbeitswelt parat hat. Aber ein wenig über den eigenen Zugang nachzudenken schadet nie. Etwa, dass wir ausblenden, wie viel von allen Seiten von uns verlangt wird. In der Rush Hour des Lebens laufen wir Gefahr, uns auf die schlechteste Art zu verausgaben. Die Kinder wachsen im Mairegen in den Himmel und brauchen neue Schuhe, und der Mairegen rinnt durch die Dachluke, und die Eltern haben im besten Fall ein Computerproblem, im schlechtesten brauchen sie eine 24-Stunden- oder eine Grabpflege. Uff, aber nur noch drei Wochen bis zum Wellnesswochenende, und einen Abend pro Woche nimmt uns der Mann die Kinder eh ab, damit wir Pilates machen können, damit wir nicht schiach werden und sich der Mann eine andere sucht, und damit wir am nächsten Tag wieder schmerzfrei vor dem Computer stillsitzen können. Wer an sich selbst arbeitet, kann mehr leisten! Und haben wir uns nicht selbst verwirklicht? Das ist auch so ein Irrtum aus den 1990ern. Mach’ dein Ding, gib’ dein Bestes, dann kannst du alles werden! Wenn der Erfolg individualisiert wird, gilt das natürlich auch für den Misserfolg. Und dass du erschöpft bist, liegt an dir. Ich kenne etliche Frauen, die sich auf Long Covid untersuchen haben lassen, weil sie immer so müde sind, und weil es nicht sein kann, dass es das System ist, das sie erschöpft.
Lasst uns bitte so faul wie nötig sein, in der Muße liegt die Kraft. Aber hören wir auf, uns durch lustlos absolviertes Yoga und Achtsamkeitsseminare fit für eine Arbeitswelt zu machen, die es wert ist, unterzugehen. Ohne ein Minimum an Leidenschaft mag ich nicht mehr dahinleben, und ich will, dass andere davon profitieren (etwa in dieser kleinen Brandrede gegen fiese Arbeitsbedingungen). Wir müssen die Aufgaben, die uns das Leben stellt, viel gerechter verteilen. Es ist nicht zu ertragen, dass sich in der sogenannten „Dritten Welt“ schon die Kinder krumm schuften müssen, nur damit wir beim Hofer Gartenmöbel zu Schleuderpreisen kaufen, auf denen wir uns von den Zumutungen der eigenen ungeliebten Arbeit zu entspannen versuchen. Es wird eben alles ein bisschen teurer, dafür weniger scheiße. Lohn muss mehr als ein Schmerzensgeld dafür sein, dass wir unseren Körper 38,5 Stunden ins Büro setzen.
Wenn ich in Sachen Lebenserwartung Kind meiner Eltern bin, habe ich jetzt noch maximal 30 Jahre, und die mag ich nicht mehr verschwenden. Denn das Leben ist schön und es macht viel Arbeit.

 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite