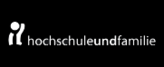Der Mensch über allem
Ohne die Wissenschaft hätte die Politik gerade wenig zu sagen. Wenn wir Glück haben, hört sie noch weiter zu. Gedanken von Susanne Schneider über merkwürdige Zeiten.
Immer schön flach halten
Es ist nicht lange her, da hat es noch so gut wie niemanden interessiert, worüber Virologinnen und Virologen gerade so nachdenken. Das hat sich nun schlagartig geändert. Die ganze Welt wartet auf die große Erlösung und bringen kann sie, so viel ist klar, nur die Wissenschaft. Aber mit Ungeduld tut sie sich schwer.


Gelernt ist gelernt
Ein an der JKU entwickelter Algorithmus sucht in einer Datenbank von einer Milliarde Molekülen nach möglichen Wirkstoffen gegen das Coronavirus. Der Mensch würde dafür Jahre brauchen – die Künstliche Intelligenz schafft es an nur einem einzigen Tag. Die Ergebnisse wurden jetzt für alle verfügbar gemacht.
Kleiner als klein
Der kurze Bammel, bevor der Arzt zusticht, die Tränen bei den Kindern, aber was heißt nur bei den Kindern: Seit langem arbeiten Wissenschaftler*innen daran, dass vor Impfungen niemand mehr Angst zu haben braucht. Mit Mikronadeln
soll der Schmerz kaum noch zu spüren sein – doch das Problem bleibt die Dosierung des Wirkstoffs. An der JKU Linz wird an einer Lösung gearbeitet.

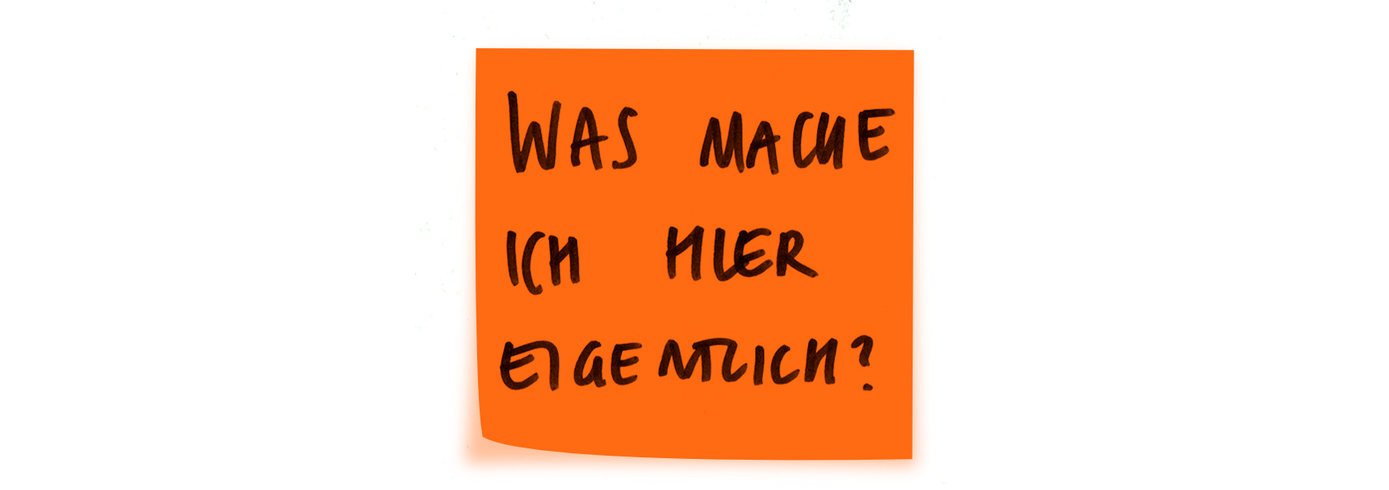
Was mache ich hier eigentlich?
Die Corona-Krise zwingt uns, unsere Arbeitswelt neu zu reflektieren. Jetzt, wo viele zu Hause sitzen, drängt sich die Frage auf: Wie sinnvoll ist das, was wir tun? Die Antwort ist schwierig. Denn: Bedeutsamkeit ist subjektiv – und sie lässt sich nicht erzwingen.
Ein dickes Ding
Astronomen glauben, das meiste, das sich da oben tut, haben wir noch gar nicht gesehen. Mit dem Riesenteleskop ELT werden sie jetzt aber weiter ins All blicken können als je zuvor. Mathematiker der JKU arbeiten daran mit, dass es detailgetreue Bilder liefert.


Guter Riecher
Der Sandfisch ist ein faszinierendes Tier. Vor Tausenden Jahren galt er als Aphrodisiakum, dann faszinierte seine Fähigkeit, durch Sand schwimmen zu können, als wäre es Wasser. Jetzt aber könnte er wegen seiner Nase das Vorbild eines neuen Partikelfilters geworden sein. Und bloß deswegen, weil er sich vor einer JKU-Forscherin so lange im Sand versteckte.
Diese Kappe liest Gedanken
Lange war der Versuch, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, der Parapsychologie vorbehalten. Heute sind es Neurowissenschaftler*innen, die mit ausgefeilter Technik die Vorgänge in unseren Gehirnen in Echtzeit entschlüsseln wollen. Der JKU könnte nun der nächste Schritt gelungen sein.


Reflexion im Reallabor
„Zusammen streamen statt zusammenströmen“ lautete das Motto der diesjährigen Diagonale, die als eines der ersten Filmfestivals online über die Bühne ging. Nun bringt Crossing Europe einen cineastischen Streifzug quer durch Europa auf die Bildschirme der Wohnzimmer. Das Ars Electronica Center bietet einen interaktiven digitalen Lieferservice, der Ausstellungstouren, Workshops, Vorträge und Konzerte umfasst.
Die Corona-Krise katapultiert auch die Kultur in virtuelle Welten. Und illustriert überdeutlich, wie stark unser Alltag bereits von einer Melange aus On- und Offline-Wirklichkeiten geprägt ist, die untrennbar miteinander verwoben sind, einander bedingen. Diese Digitalisierung mit dem Vorschlaghammer mündet in ein großes Reallabor, in dem Experimente mit enormer Spannweite in situ in der Gesellschaft gewagt werden.
Mit Hilfe von digitalen Werkzeugen entstehen innovative Vermittlungsansätze, die es erlauben, neue Zielgruppen zu erschließen und Hemmschwellen abzubauen – vieles davon wird die Krise überdauern. Die Pandemie löst einen Lernprozess darüber aus, welche Angebote im Netz funktionieren und welche nicht, und generiert bei vielen die Erkenntnis, dass wir schon längst in der real-digitalen Sphäre leben, wo es kein Entweder-oder zwischen dem Realen und dem Digitalen gibt, sondern der Schlüssel des Erfolgs in einer hybriden und klugen Verbindung von beidem liegt.
Das Realexperiment in der Ära von COVID-19 manifestiert aber auch den Wert von Kunst und Kultur als Instrument der Reflexion.
Der globale Lockdown zeigt die Wichtigkeit und die Kraft von Kreativität – also der einzigen menschlichen Gabe, die es erlaubt, uns in unvorhersehbaren Situationen zurechtzufinden.
Im Reallabor zur Abwehr des Coronavirus werden einst als undenkbar gehandelte Maßnahmen Realität, die einen Eingriff in unsere Grundrechte darstellen. Sie verlangen nach kritischen Stimmen, um vielschichtige Diskurse anzuregen und der Allgemeinheit einen Spiegel vorzuhalten. In alledem liegt die Stärke der Kunst, sie provoziert eine Perspektivenverschiebung, emotional, intellektuell oder ästhetisch. Geänderte Blickwinkel und Betrachtungsweisen eröffnen neue Erkenntnisse. Sie sind ein wesentlicher Nährboden für Kreativität, kritische Reflexion oder Kurskorrekturen.
Doch während die Wissenschaft gerade vor den Vorhang geholt wird und Virolog*innen, Mediziner*innen oder Mathematiker*innen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, findet Kultur plötzlich im stillen Kämmerlein statt. Die sozialen, ökonomischen, politischen und ethischen Fragen, die COVID-19 aufwirft, bedürfen jedoch transdisziplinärer Ansätze an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Der Bruch mit traditionellen Sehgewohnheiten, die Erweiterung des methodischen Erfahrungshorizonts und der spartenübergreifende Erkenntnisgewinn entsprechen der Multidimensionalität unserer vernetzten Welt und den Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Nicht zuletzt dokumentiert auch der Blick in die Geschichte ein Oszillieren zwischen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technologie als Innovationstreiber der Menschheit.
Umso entscheidender ist es, die existenzielle wirtschaftliche Katastrophe für den Kulturbetrieb zu verhindern und die Kunst als geistige Grundlage unserer Gesellschaft vor dem Aussterben zu bewahren. Schließlich offenbart der Ausnahmezustand: Der vorübergehende Verzicht auf kulturelle Öffentlichkeit bedeutet einen nie dagewesenen Verlust an Lebensqualität, Inspiration und Kontemplation. Die aktuelle Situation führt uns eindringlich vor Augen, dass die Kulturlandschaft kein dekorativer Luxus ist, mit dem man sich nur in guten Zeiten schmückt, sondern kollektiver Kitt und ein unentbehrliches Korrektiv in der Krise.
CHRISTOPHER LINDINGER beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit neuen Technologien, Innovationskulturen und Kooperationsformen für Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Er forschte in Chicago zu Supercomputer-Visualisierungen, entwickelte Software für NASA, NCSA und war Forschungsdirektor des Ars Electronica Futurelabs. Seit 2019 ist er JKU-Vizerektor für Innovation und Forscher*innen.
Kultur in der Krise
Für die Kultur sind Krisen höchst dynamische Prozesse, Höhepunkte, an denen sich neue Wege auftun. Und – es gibt viel zu tun in Krisenzeiten.
COVID-19 wirft Probleme und Fragen auf, die nicht neu sind. Das bedrohliche Virus wird mit einem Brennglas oder Röntgenstrahl verglichen, die soziale, politische, ökonomische Zusammenhänge sichtbar machen – COVID-19 vergrößert wie eine konvexe Sammellinse gesellschaftliche Ungleichheiten, Ausschlussformen und nationale Herrschaftsstrategien und legt diese auf radikale Weise bloß.
Von der Möglichkeit der Veränderung sprechen die einen, von dem Wunsch, Normalität wiederherzustellen, die anderen. Doch welche Normalität? Prekariat, Ausbeutung, Demokratieverdruss, Ressourcenverschleiß und Klimawandel auf Kosten der anderen. Und Wohlstand, Gesundheit und Glück für manche. Es ist also eine Frage der Perspektive – der Blick auf blühende Landschaften mag den Blick auf Inseln aus Plastikmüll, Berge von Elektronikschrott, auf einstürzende Textilfabriken, Bildungs- und Geschlechterungerechtigkeiten, Krieg und Gewalt vergessen machen. Die Einhegung der Disziplinen mag die Errichtung von Parallelwelten erlauben. Es bedurfte bloß eines unsichtbaren Virus, um diesen Schein wie eine Seifenblase zerplatzen zu lassen.
COVID-19 hätte das postfaktische Zeitalter beendet, sagt die Wissenschaftshistorikerin Helga Nowotny. Die Wissenschaften waren bis vor kurzem weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen der politischen Aufmerksamkeit, da sie unter Umständen auch unangenehme Dinge zu verkünden hatten und haben. Kann nun aber der bange Blick auf die magischen Kurven von Krankheit und Tod allein das Verhältnis zu den Wissenschaften verändern? Die Wissenschaften brauchen Kritik und Differenz, um Perspektiven zu überprüfen, in Frage zu stellen, neue Sichtweisen einzunehmen und diese unter Umständen wieder zu verwerfen. In ihrer Praxis müssen sie frei sein, frei von kommerziellen oder politischen Interessen und diese Freiheit teilen sie mit Kunst und Kultur. Zu deren Strategien gehören Experiment, Überschuss und Interdisziplinarität – diese mit den Wissenschaften in Austausch und Widerstreit zu bringen ist genauso unentbehrlich wie die gesellschaftliche Kommunikation und die öffentliche Debatte darum.
Die Kraft der Kunst, sagt Christoph Menke, läge in der Möglichkeit, in der Freiheit – und Hannah Arendt würde ergänzen, in der Möglichkeit zu handeln. Das Vermögen zu handeln wäre dabei zu unterscheiden vom „Sich-Verhalten“. Gerade jetzt, wo es angezeigt ist, eine Reihe von Verhaltensregeln im Umgang miteinander zu beachten, um die Pandemie einzuschränken, dürfen wir nicht vergessen, was es heißt zu handeln, dürfen wir Regeln nicht mit Repressionen und Freiheit nicht mit Rücksichtslosigkeit verwechseln. Gerade jetzt kommt Kunst und Kultur die Aufgabe zu, Narrationen zu entwerfen, die uns eine diskursive, ästhetische Auseinandersetzung mit Fragen der Ethik, des Rechts, der Souveränität und des Subjekts auferlegt.
EVA MARIA STADLER ist Vizerektorin für Ausstellungen und Wissenstransfer an der Universität für angewandte Kunst Wien, darüber hinaus ist sie Professorin für Kunst und Wissenstransfer und Institutsvorständin am Institut für Kunst und Gesellschaft an der Universität für angewandte Kunst in Wien und arbeitet als Kuratorin für zeitgenössische Kunst.


Im Schnellvorlauf
Virusnachweise im Genlabor, hoffentlich bald ein Medikament gegen COVID-19 und ein green new deal für die Zeit danach: Bei allem Negativen zeigt sich in der Corona-Krise auch die Chance für neue Konzepte in der Wirtschaft, in der Forschung und in der Art, wie wir künftig arbeiten und leben.
Somnium - der Traum von Wissenschaft
Ich muss mich beim Hexen versprochen haben“, sagte die kleine Hexe. Früher war ihr auch schon dann und wann etwas danebengegangen. Aber gleich viermal hintereinander?
Tja, das kann schon einmal vorkommen, wenn man sich mit Biologie, Chemie und Physik beschäftigt. Da geht ein und dasselbe Experiment mehrmals hintereinander daneben. Ganz so, wie bei der kleinen Hexe von Otfried Preußler. Seit ich mich erinnern kann, bin ich von all diesen Naturwissenschaften fasziniert. Weil es ein bisschen wie Zaubern und Hexen ist. Aus dem, was uns die Natur so gibt, Neues zu schaffen. Zu kombinieren. Wirkungen und Effekte zu erzielen, einfach damit, dass man zusammenfügt, was gar nicht zwangsläufig zusammengehört.
Dabei war mein Weg in die Wissenschaft gar kein direkter. Es war eher so wie in der Geschichte, als die kleine Hexe zum ersten Mal auf ihrem neuen Zauberbesen reitet: ein ziemlich wilder Ritt. Nach der Schule, bei mir war es die Polytechnische Schule, begann ich eine Lehre. Zuerst als Drogistin und danach noch eine Lehre als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Da waren sie schon, die Naturwissenschaften. Nur mein Drang nach Wissen war damit noch nicht gestillt. Erst mit der Berufsreifeprüfung kam das Gefühl, dass ein Studium mein Weg sein könnte. Und auch wenn es Physik wurde – für mich waren und sind Naturwissenschaften immer interdisziplinär. Physik, Chemie, Biologie. Das sind Seiten desselben Buches und man sollte sie nicht gegeneinander, sondern miteinander lesen und verstehen.
Mittlerweile forsche und arbeite ich in einem großartigen Team an biologisch abbaubarer Elektronik und jetzt auch Robotik. Also, ganz einfach formuliert, an Robotern und Elektronik, die unsere Umwelt nicht belasten, sondern aus möglichst natürlichen Werkstoffen gebaut werden. Ganz oft geht es uns da wie der kleinen Hexe und wir haben das Gefühl, dass wir uns versprochen haben, weil wieder mal etwas nicht funktioniert. Umso schöner ist das Gefühl, wenn es dann klappt. Und dann komme ich meinem Traum ein kleines Stück näher: Dass es irgendwann solche Roboter ganz normal im Geschäft zu kaufen gibt und ich dann zu meinem Sohn sagen kann: Da hat die Mama mitgearbeitet. Und dann freue ich mich auf das Leuchten seiner Augen und den Stolz, dass seine Mama eine kleine Hexe ist.


Im Gegenwartezimmer
Norbert Trawöger sinniert über das Anfangen, die Ungeduld, die Vergegenwärtigung der Gegenwart in der Gegenwart und fragt sich, wie man Expertinnen und Experten erkennt. Dies alles vom Logenplatz aus.
Japan – Inselreich in Bewegung
Während in Österreich erste Lockerungen des Shutdown beginnen, weitet Japans Premierminister Shinzo Abe den Ausnahmezustand von zunächst sieben auf alle 47 Präfekturen des Landes aus. Die Bevölkerung wird ersucht, ihre persönlichen Kontakte um 70 bis 80 Prozent zu reduzieren. Firmen werden aufgefordert, möglichst auf Heimarbeit umzustellen. Um etwa einen Monat zeitverzögert, vollzieht Japan Mitte April die allmähliche Stilllegung des Landes. Die Geschäftsstraßen sehen aus wie sonst nur zu Neujahr, wenn sich das ganze Land rund eine Woche lang zu Familienfeiern ins Haus zurückzieht.
Ich hatte geglaubt, dass die japanische Höflichkeit und Etikette mit ihrem kulturell verwurzelten Abstandhalten und Maskentragen das Inselreich von Corona weitgehend verschonen würde. War doch dort das kollektive und feucht-fröhliche hanami, das Bestaunen der Kirschblüte, noch zu einem Zeitpunkt möglich, als wir hier das Haus längst nur mehr in den erlaubten seltenen Fällen verließen. Einzeln. Maximal zu zweit. Dann hatte Abe Ende März an die Menschen in Tokyo, Osaka und anderen Großstädten appelliert, doch ein Wochenende lang mal freiwillig zu Hause zu bleiben. „Wir machen dieses Wochenende social distancing“, ulkte eine Freundin in Tokyo, mit der ich über den japanischen Messenger-Dienst LINE telefonierte. Freund Ogino erzählte über LINE, dass er seine 98-jährige Mutter nicht mehr besuchen dürfe. Er habe bei der Rezeption des Altersheimes eine Portion Eiscreme für sie abgegeben. Sie lebt auf der Demenzstation. Ihren Sohn erkennt sie schon lange nicht mehr. Ihre Leidenschaft für Eiscreme ist geblieben. Im April hatte ich sie noch besucht. Sie hatte mich erstaunt angesehen und eine der Mannerschnitten, die ich ihr mitgebracht hatte, in kleinen Stückchen gemümmelt. Ogino war nach Kyoto gekommen, um nach einer Knieoperation die Schrauben herausnehmen zu lassen. Ansonsten lebt er in Thailand. Während er in Kyoto im Krankenhaus war, machte Thailand die Grenzen dicht und ließ ihn nicht mehr zurückreisen. „Sho ga nai“, sagte er schicksalsergeben. Da kann man nichts machen.
Eine Woche ehe nun auch Abe in Japan erste Maßnahmen ergriff, war die Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokyo wegen der weltweiten COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Seit klar ist, dass 2020 nicht das Jahr der Olympischen Spiele in Tokyo wird, werden täglich mehr Corona-Fälle veröffentlicht. Japan habe die tatsächlichen Zahlen der Corona-Erkrankungen verschleiert und Maßnahmen verzögert, um die Austragung der Olympischen Spiele nicht zu gefährden, meinen böse Zungen.
Die Universität meiner ehemaligen Studentin Yui hat bis September Online- Unterricht verordnet. Yui schickt mir eine Liste mit Vorschriften, an die sie sich halten muss. Alle Studierenden sind angehalten, nicht auszugehen und keine Reisen zu unternehmen, außer in unbedingt notwendigen und dringenden Fällen. Gehört unser Hiroshima- Projekt dazu? Aus der Sicht der japanischen Behörden wohl eher nicht. Mit Yui als einer meiner wichtigsten Protagonistinnen wollte ich einen Film zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima im August 2020 drehen. Es sollte eine Spurensuche mit der Enkelgeneration werden. Yuis Großvater war ein hibakusha, ein Überlebender der Atombombe. Sie hat seine Geschichte aufgearbeitet und niedergeschrieben und arbeitet nun an ihrer Dissertation über die Traumatisierung von Atombombenüberlebenden. Es wird ein Pionierwerk werden, denn darüber hat in Japan bislang noch niemand geforscht.
Meine Bekanntschaft mit Yui Aiba hat 2014 in Nagoya begonnen. Ich hatte an der Städtischen Universität Nagoya einen Lehrauftrag im Rahmen der vergleichenden Kulturwissenschaften. Als Thema meiner Vorlesung hatte ich zwei Werke des österreichischen Journalisten und Friedensaktivisten Robert Jungk gewählt, „Der Atomstaat“ und „Strahlen aus der Asche“, das erste Werk in deutscher Sprache über die Folgen der Atombombe in Hiroshima. Vor dem Hintergrund der atomaren Bombardierung Hiroshimas und der Nuklearkatastrophe von Fukushima erschienen mir Jungks kritische und pazifistische Annäherungen an das Nukleare für junge Menschen in Japan ausgesprochen gut geeignet. Doch ich hatte nicht mit dem großen Desinteresse und dem historischen Nicht-Wissen der Studierenden gerechnet. Ein erster Zwischentest fiel katastrophal aus. Um nicht 90 Prozent der Studierenden negativ beurteilen zu müssen, bot ich ihnen als Lösung an, zu ausgewählten Themen, die freilich zur Vorlesung passen müssten, einen Essay zu schreiben, damit sie sich ihre Note verbessern konnten. Bereits nach der nächsten Stunde kam ein Mädchen zu mir und gab eine Arbeit von mehreren Seiten ab. Sie habe das gleich in der Vorwoche geschrieben. Ich warf einen kurzen Blick auf den Titel und erhaschte die Worte: „Mein Großvater, 6. August 1945, Hiroshima …“ Das war meine erste Begegnung mit Yui. Ich nahm den Aufsatz mit nach Hause und las ihn beim Abendessen. Er rührte mich zu Tränen. Sie hatte ihren Großvater interviewt, der als 18-Jähriger eingezogen und von Nagoya nach Hiroshima beordert worden war. Der damals 88-jährige Großvater, erzählt Yui in ihrem Aufsatz, habe schon viele Male darüber reden wollen, dass er selbst ein hibakusha, also ein Überlebender der Atombombe ist, aber sie habe seine Geschichte einfach nicht hören wollen. Durch die Vorlesung über Robert Jungk und die Lektüre von „Strahlen aus der Asche“ sei sie motiviert worden, ihm zuzuhören, ihm Fragen zu stellen.
Was er zu erzählen hatte, war schrecklich: Der junge Mann musste nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima die Leichen bergen helfen, über Details aber könne er bis heute nicht sprechen. Sie habe ihn auch gefragt, schreibt sie, ob er Hass auf die USA empfinde, und der Großvater habe geantwortet: „Nein, denn die USA hätten schließlich durch die Atombomben den Krieg beendet, den Japan sonst ewig weitergeführt hätte.“ Der Großvater, schreibt Yui, habe in ihrem ersten Gespräch auch – ganz im Sinne meiner Lehrveranstaltung und im Sinne Jungks – den Bogen zu Fukushima und zur Atomenergie gespannt und sei dafür eingetreten, Japan möge sofort aus der Atomenergie aussteigen und alle AKWs abschalten. Zu Semesterende kam es zu einer ersten Begegnung zwischen mir, dem Großvater und Yuis Mutter. Ich hatte gebeten, den Großvater für eine Radiosendung interviewen zu dürfen, und an einem Sonntagvormittag kam die ganze Familie in mein Büro an der Universität. Als ich auf ihr Klopfen die Türe öffnete, standen sie vor mir, strahlend, der Großvater mit einem kleinen Leiterwagen (!), auf dem er alle Materialien, Bücher, Zeitungsartikel, Bilder und Dokumente in großen Kisten mitbrachte, die er seit jenem 6. August 1945 gesammelt hatte …
Ihre Abschlussarbeit an der Universität schrieb Yui über die hibakusha in der Präfektur Aichi, wo sie lebt. Im Februar 2018 kam sie eigens nach Wien, um mir ihre Arbeit zu überreichen. Ihre Magisterarbeit über ihren Großvater erschien Anfang 2019 als Buch und wurde in Japan viel beachtet. Bei jeder Japanreise traf ich Yui, ihren Großvater, ihre Großmutter und ihre Mutter. Sie luden mich zum Essen ein und erwiesen mir ihre Dankbarkeit. Im Herbst 2019 war der Großvater bereits zu schwach für die geplanten Dreharbeiten mit seiner Enkelin in Hiroshima. Wir führten ein letztes Skype-Gespräch. Der Großvater lag im Bett. Wir winkten uns zu. Ich solle mich um Yui kümmern, gab er mir mit. In den Weihnachtsferien besuchte ich Yui und ihre Familie. Ich konnte nur mehr kondolieren. Auf dem Hausaltar standen Fotos von unseren Treffen und die letzte Notiz, die sich der Großvater nach dem Skypen im Oktober gemacht hatte: „Mit Frau Brandner gesprochen. Es war sehr erfreulich. Sie wird im Dezember auf Besuch kommen. Ich bemühe mich, bis dahin durchzuhalten.“ Wir haben uns knapp verpasst. Am 10. November starb er im Alter von 93 Jahren. Ich habe Yui und ihrem Großvater ein Kapitel in meinem Buch „Japan – Inselreich in Bewegung“ gewidmet, das im Herbst 2019 im Residenz Verlag erschienen ist. Yui und ich üben uns in social distancing und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.


Das positive Denken – das Positive denken
Dieser Text ist noch vor Ausbruch der Corona-Krise entstanden. Die Autorin hat darauf verzichtet, ihn für die Zeit der Quarantäne zu adaptieren, um Ihnen ein paar Minuten ohne Viren, Ausgangsbeschränkungen und Infektionsraten zu gönnen. Zudem ändert sich nichts an der Grundhaltung. Es hat sich nur die Dankbarkeit der Autorin gegenüber jenen, die uns das gute Leben ermöglichen, weiter vertieft.
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite