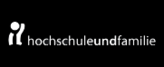Another life is possible
Die Zukunft wirkt durch Dauerkrisen wie eine einzige Katastrophe und dass es schnell zurück in die gute alte Zeit gehen kann, glaubt seit dem Krieg in der Ukraine auch niemand mehr. So wie bisher können wir aber nicht weitermachen. Das ahnen fast alle. Aber begreifen wir es auch? Ein Essay von Stephan Lessenich.
But how?
Die Situation mag manchmal aussichtslos erscheinen, aber sie ist es nicht. Die Ansätze dazu, wie die Menschheit dieses Zeitalter der multiplen Krisen mit einem blauen Auge überstehen kann, gibt es. Und sie werden mehr.


Die biegbare Batterie
Je smarter die Welt wird, desto mehr Elektronikschrott türmen wir auf. Doch es geht auch anders: Ein Team der JKU hat jetzt eine weiche, dehnbare Batterie entworfen, die sogar biologisch abbaubar ist.
Eine Frage der richtigen Fragen
Ein Quantencomputer kann nicht nur null und eins unterscheiden, sondern arbeitet auch mit beliebigen Kombinationen davon. Um diese Fähigkeit effizient zu nutzen, muss man das Ergebnis aber auch rasch und zuverlässig auslesen können – und das ist bis heute ein großes Problem. Richard Küng von der JKU gelang nun ein wissenschaftlicher Durchbruch: Er fand heraus, dass diese Messung am besten funktioniert, wenn man dabei ausgeklügelte Fragen stellt.


Teile und herrsche nicht!
Der Traum einer kooperativen Sharing Economy ist trotz der negativen Erfahrungen mit großen Plattformen wie Uber und AirBnB noch nicht geplatzt. Doch für ihre Rettung müssen Politik, private Akteure und Zivilgesellschaft strategischer denken.
Verbrechen und Strafrecht
In weiten Teilen der Welt wird die Todesstrafe geächtet. In manchen jedoch erlebt sie zurzeit eine Renaissance. Aber sind höhere Strafen bis hin zu diesem Extrem überhaupt ein geeignetes Mittel, die Kriminalität einzudämmen?


Kristallwelten
Grundlagenforschung kann den Horizont sprengen und Universen an neuen Anwendungen eröffnen. Am Institut für Halbleiter- und Feststoffphysik erzeugen Alberta Bonanni und ihr Team deshalb Kristalle. Sie haben ganz erstaunliche Eigenschaften.
Einfach mal machen
Vom lebensrettenden T-Shirt über einen High-Tech-Rollstuhl bis zur Plattform für regionale Lebensmittel – die JKU ist die Basis für eine Reihe von Start-ups, die etwas oft Unterschätztes in den Mittelpunkt stellen: Echte Bedürfnisse, die noch nicht gestillt sind.


Unter Spannung
„Wir sind uns wohl alle einig, daß [sic] es die Aufgabe von Bildung ... war, ist und wahrscheinlich bleiben wird, die Jugend auf das Leben vorzubereiten. Wenn dies aber der Fall ist, dann steht die Bildung (einschließlich der universitären Bildung) jetzt vor der tiefsten und radikalsten Krise in ihrer an Krisen reichen Geschichte“, erklärte der Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman in einem Vortrag an der Universität Padua.1 Er bezog sich dabei auf seine Theorie der „Liquid Modernity“, die er so beschrieb: „Die Formen des modernen Lebens können sich in einiger Hinsicht unterscheiden – aber was sie alle verbindet, ist genau ihre Zerbrechlichkeit, Zeitlichkeit, Verwundbarkeit und Neigung zu ständigem Wandel.“2 Ein Phänomen, das gerade jetzt eine dramatische Bestätigung erfährt.
Doch funktioniert unser aktuelles Bildungs- und Wissenschaftssystem im Wesentlichen noch immer nach den Prinzipien des Industriezeitalters des 18. und 19. Jahrhunderts: Wissensproduktion, Wissenserwerb, Wissensvermehrung durch intellektuelle Arbeitsteilung. Die Fragmentierung der Wissenslandschaft ist in den letzten Jahrzehnten rasant vorangeschritten. Im Jahr 2018 gab es etwa 42.500 aktive wissenschaftliche Peer- Review- Zeitschriften, die zusammen über drei Millionen Artikel pro Jahr veröffentlichten. Alle zehn Sekunden erscheint ein wissenschaftlicher Artikel.
Parallel dazu ist die Welt immer komplexer geworden. Es scheint: Alles hängt mit allem zusammen. Ein Schiffsunfall im Suezkanal legt Fabriken in Europa lahm. Eine kranke Fledermaus auf einem chinesischen Markt dürfte eine weltweite Pandemie verursacht haben, die unser Sozialverhalten auf den Kopf stellt, mehrere Millionen Todesopfer und enorme wirtschaftliche Schäden fordert.
Fast ein Jahrhundert, nachdem Heisenberg die Unschärferelation formulierte und seine Theorie der Quantenmechanik die Paradigmen der Physik und sogar der Philosophie gebrochen hat, sind wir immer noch gewohnt, weitgehend in isolierten disziplinären Silos mit fragmentiertem Wissen nach linearen Kausalitätsmustern zu argumentieren und zu handeln.
Während die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Realitäten gleichzeitig von der Komplexität einer wachsenden Zahl und in ihren Wechselwirkungen immer unübersichtlicher werdenden Faktoren bestimmt werden, versuchen Politik und Wirtschaft verzweifelt, die lineare Gestaltungslogik des Industriezeitalters aufrechtzuerhalten.
Bildung und Wissenschaft orientieren sich am Paradigma eines Erkenntnisfortschritts, der primär innerhalb von Disziplinen oder subdisziplinären Nischen definiert und anhand von quantitativen bibliometrischen Indikatoren gemessen wird. Dass komplexe Wirkungsmechanismen immer öfter die Grenzen einer wissenschaftlichen Disziplin überschreiten, wird in unserem Bildungs- und Wissenschaftssystem weitgehend ausgeblendet.
Schon 2009 hat der European Research Area Board einen Paradigmenwechsel im Denken und in der Rolle der Wissenschaft gefordert: Ein neues „holistisches Denken“ sei notwendig, Wissenschaft und Forschung sollten „mehr auf die systemischen Effekte achten als auf die engen Ziele“. „Preparing Europe for a New Renaissance“ war der bemerkenswerte Titel des Berichts.3
Der International Science Council, ein Dachverband der prominentesten Forschungsorganisationen aus der ganzen Welt, wie z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der FWF, die Royal Swedish Academy of Sciences, die Schweizerische Akademie der Wissenschaften, die US National Academy of Sciences, die British Academy, hat 2021 einen Bericht veröffentlicht, in dem er die Notwendigkeit betont, „Innovation durch disziplinübergreifende Zusammenarbeit anzuregen“. Man müsse „die gegenwärtigen globalen Herausforderungen als miteinander verflochtene natürliche und soziale Probleme verstehen und gestalten und daher den Sozial- und Geisteswissenschaften sowie der Kunst eine herausragende Führungsrolle zuweisen, ohne die wichtigen Beiträge der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der Medizin zu negieren“.4
Bei all dem darf die so dringend gebotene Interdisziplinarität nicht gegen die Vertiefung in den Disziplinen ausgespielt werden. Der unbedingt notwendige Blick über den Tellerrand braucht ein starkes disziplinäres Rückgrat. Interdisziplinarität gelingt meist dort am besten, wo exzellente Vertreterinnen und Vertreter ihres jeweiligen Faches an gemeinsamen fachübergreifenden Projekten arbeiten. Interdisziplinäre Strukturen bedürfen – meist in Form eines iterativen Prozesses – immer wieder des Rückgriff s auf die Exzellenz in den Disziplinen. Wie der Deutsche Wissenschaftsrat daher zu Recht betont, sind Disziplinarität und Interdisziplinarität zugleich konstitutive Elemente des modernen Wissenschaftssystems.5 „Disziplinäre und interdisziplinäre Ansätze können gleichermaßen sachgerecht sein und sind daher grundsätzlich gleichwertig.“
Es ist in der Tat bemerkenswert, dass herausragende Institutionen des globalen Forschungssystems einen Wandel der Wissenschaftskulturen einfordern, weil „das Wissenschaftssystem derzeit nicht so organisiert und motiviert ist, dass Wissenschaftler effektiv dazu beitragen können, Antworten auf globale existenzielle Bedrohungen zu finden und umzusetzen“.6
Die Erkenntnis, dass wir den drängenden globalen Herausforderungen nicht mit „more of the same“ begegnen können, sondern dass wir in Forschung und Lehre die business-as-usual-Ansätze verlassen müssen, scheint an Boden zu gewinnen.
Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde der klassische Kanon der Kulturtechniken – Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen – durch die Fähigkeit zur digitalen Artikulation und Kommunikation ergänzt. Alle, die diese Fähigkeit nicht beherrschten, wurden als digitale Analphabeten mit sozialer Ausgrenzung bestraft und hatten signifikante Nachteile am Arbeitsmarkt zu erleiden.
Jetzt muss dieser Kanon der Kulturtechniken neuerlich erweitert werden.
Die Vermehrung des Wissens in den einzelnen Spezialdisziplinen wird wie gesagt weiter unverzichtbar sein, aber zusätzlich muss unser Bildungssystem die Kompetenz zur Vernetzung von Wissen verstärken – auf einer Ebene, die mit Algorithmen (noch) nicht erreichbar ist und deren Zielrichtung bereits das geltende Universitätsgesetz vorgibt: „Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen.“
Es ist hoch an der Zeit, der kreativen Synthese von Wissen nun mindestens ebenso große Wichtigkeit in unserem Bildungs- und Forschungssystem zuzuerkennen wie der Vermehrung des Wissens. Ungewöhnliche Verbindungen herstellen, Perspektiven wechseln, mit Ungewissheit, Unvorhersehbarkeit und Mehrdeutigkeit arbeiten; deshalb brauchen wir auch das Alphabet der Kunst im Prozess gesellschaftlicher Innovationen in Zeiten radikaler Umbrüche.
1 Bauman, Zygmunt (2011), Liquid modern challenges to education, Lecture given at the Coimbra Group Annual Conference – Padova, 26 May 2011
2 Bauman, Zygmunt (2000), Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, UK
3 European Commission (2009), Preparing Europe for a New Renaissance, A Strategic View of the European Research Area
4 International Science Council (2021), Unleashing Science: Delivering Missions for Sustainability, S. 33
5 Deutscher Wissenschaftsrat (2020), Wissenschaft im Spannungsfeld von Interdisziplinarität und Disziplinarität – Positionspapier, S. 47 f
6 International Science Council (2021), Unleashing Science: Delivering Missions for Sustainability, S. 17
„Wir erklären Kindern Wissenschaft, damit wir sie selbst besser verstehen“
Der Zirkus des Wissens schafft an der JKU einen ganz besonderen Ort, an dem Wissenschaft durch Theater auf ganz andere Art auf ein ganz anderes und junges Publikum trifft. Zirkusdirektor Airan Berg über seine Aufgaben in der Manege, den Zirkus namens Leben und den Zauber von Wissen.


Unordnung
Wie entsteht aus Chaos Struktur? In der Theoretischen Physik verbindet diese Frage so unterschiedliche Themen wie Tsunamiwellen und Kometenschweife. JKU-Professor Tobias Kramer räumt hier ganz schön auf, und zwar mit Grafikkarten.
Bis hierher und nicht weiter
Unser Immunsystem wirft alles raus, was uns potenziell schaden kann. Damit das funktioniert, muss es ganz schön viele Stellen koordinieren.


Somium - der Traum von Wissenschaft
Wovon träume ich? Das ist die Frage dieser Kolumne. Dabei möchte ich eigentlich aufhören zu träumen. Ich möchte nicht länger nur davon träumen, dass es uns gelingt, der Klimakrise ernsthafte Antworten entgegenzuhalten. Ich möchte nicht weiter davon träumen, wie meine Heimat Indonesien aussieht, wenn die Folgen der Klimakatastrophe nicht schon so spürbar werden. Ein Land ohne Dürren und Überflutungen, ohne Erdrutsche, Wirbelstürme und Hitzewellen. Den Folgen des Albtraums, den wir als Menschen durch unser rücksichtsloses Verhalten im Umgang mit unserem Planeten selbst erzeugt haben.
Träume hindern Menschen auch oft genug daran, zu tun. Wir träumen von einer besseren Welt, von einem schöneren Morgen. Aber im Heute und ohne Traum tun wir dann oft viel zu wenig. Ich wollte schon als Kind verstehen, warum das so ist: Warum viele Menschen so großen Träumen so kleine Taten folgen lassen. Ich habe mich mit Philosophie und Psychologie beschäftigt. Über Neurowissenschaften bin ich jetzt im Studium der Künstlichen Intelligenz gelandet. So habe ich bei einem Hackathon ein Spiel entwickelt – mit dem Menschen nicht Pokemons auf ihrem Handy fangen, sondern ihren Müll in den richtigen Mülleimer bringen. Reicht das? Nein. Das tut es nicht. Nicht für den Planeten. Nicht für mich. Nicht für unsere Gesellschaften und nicht für meine Heimat Indonesien. Und es reicht auch deshalb nicht, weil diese Herausforderung nicht von einem oder einer alleine gelöst werden wird. Diesen Traum von einem besseren Morgen können wir nur leben, wenn aus dem Traum von vielen die Aktion von vielen wird.
In den letzten beiden Jahren habe ich durch die Corona- Krise gelernt, wie schwer es ist, wenn wir uns nicht sehen dürfen und trotzdem zusammenarbeiten müssen. Ich träume davon, dass wir die Antworten gemeinsam entwickeln. Mit Freude. Mit Lachen. Mit dem Optimismus der vielen. Ein Baustein auf diesem Weg wird die Festival University an der Johannes Kepler Universität in Linz sein. Im Rahmen des Ars Electronica Festivals treffen sich hier 200 junge Menschen aus der ganzen Welt und setzen sich vier Wochen lang mit den großen Herausforderungen, den großen Alb träumen und den Antworten unserer Zeit auseinander. Mein Name ist Nathanya. Ich bin 21 Jahre alt. Und ich möchte ein Teil der Generation sein, die aufhört zu träumen und anfängt zu antworten.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal haben wir mit Nathanya Queby Satriani, AI-Studentin und Teilnehmerin der diesjährigen Festival University, gesprochen.
„Mitwelt“ statt „Umwelt“
Ein Denkanstoß zum „wording“ in der Klimakrise


Am Anfang steht Ansfelden.
Am Anfang steht Ansfelden, nicht Städte wie Bonn, Hamburg oder Wien. Die Welthauptstadt der Musik war Anziehungsort und oft Endpunkt für Klangschaffende. Der junge Ludwig van Beethoven kam aus Bonn, um bei Wolfgang Amadé Mozart in Wien in die Lehre zu gehen. Der hatte gerade keine Zeit für ihn. Als Beethoven wiederkehrte und blieb, war Mozart schon tot. So nahm er bei Joseph Haydn Unterricht. 1872 übersiedelte der in der Hansestadt Hamburg geborene Johannes Brahms für sein letztes Lebensvierteljahrhundert nach Wien, wo er 1897 knapp ein halbes Jahr nach Anton Bruckner starb. Gestorben sind sie alle in Wien, die großen Männer der vergangenen Musikgeschichte. Das hat sich geändert, wie Komponistinnen viel zu langsam, aber sicher mehr Rolle spielen, wenn auch die Musik in der Gesellschaft eine ganz andere.
Aber zurück zum Anfang und Ansfelden. Am 4..September.1824 wird dort Anton Bruckner als erstes von elf Kindern – von denen fünf überleben. – geboren. Als Sohn von Theresia (1801–1860) und Anton Bruckner (1791–1837), der als Schullehrer und Kirchenmusiker in Ansfelden tätig war. Anton Bruckner kommt vom Land, das er und das ihn nie verließ, selbst als er seine letzten Lebensjahrzehnte in der Donaumetropole Wien verbracht hat. Wenige Komponisten von Weltrang kommen aus ländlichem Umfeld. Hier ereignete sich Bruckner zwischen Kyrie rufen und Landlerschritten, Tanzboden und Kirchtürmen, Hügeln und Wäldern. Wer hört, der kann es hören. Eigen war er ganz gewiss. Bruckner gehört zu uns, gehört uns aber nicht. Seine Musik gehört der ganzen Welt, wird in der ganzen Welt gespielt und gehört. Bruckner ist mehr als Oberösterreich, von wo er aufbrach. Er ist Welt, aber er kommt von diesem Land, diesem Ort: „Locus iste“ – was nichts anderes heißt als „Dieser Ort“ – sind die Anfangsworte der lateinischen Motette für vierstimmigen gemischten Chor, die zu Bruckners Welthits zählt.
Die Sorge von Bruckners Vater für die Kirchenmusik des Orts galt früh dem musikalischen Sohn. Vielleicht, weil es sich so gehört hat. Sein Feuer wurde angezündet, die Blasbälge der Ansfeldner Orgel sorgten für reichliche Sauerstoffzufuhr. Die Orgel ist der Ort, an dem Bruckner sein Handwerk anzulegen beginnt. Über dem Hügel lag Sankt Florian, es liegt dort immer noch, wie der Entfachte selbst unter seiner Orgel. Das Stift war für den blutjungen Bruckner, wo er nach dem frühen Tod seines Vaters Sängerknabe wird, eine frühe Ahnung von einer ganz anderen Dimension. (Eine Vorahnung hat er wohl schon in Ansfelden erfahren. Der stattliche Pfarrhof wurde –.wie das Stift – vom Barockbaumeister Carlo Antonio Carlone erbaut, in dem die Pröbste von St. Florian ihre Sommerfrische verbrachten.) Die Tradition, der Kirchenraum expandiert sein Vorstellungsvermögen. Bis heute staunt man über die Ausmaße des Stifts. Eine Großmächtigkeit, die durchaus Einschüchterndes an sich hat und im besten Fall Demut auszulösen vermag. In den Weiten und Engen des sakralen Gehäuses wächst Bruckner heran. Und nicht nur das, dieser steht auf dem Land, auf der grünen Wiese, nahe der größeren Stadt Linz, die damals noch kleiner und viel ferner war als heute.
Bruckner geht nach Linz, wird Domorganist. Im Linzer Theater hört er Wagners „Tannhäuser“. Dieses Ereignis wird ihm zum Erweckungserlebnis, „gibt“ ihm die Erlaubnis zum Eigenen. Der Ausbruch ist im Gange. Er sorgt selbst unablässig dafür. Hätte er nicht ein ewiger und unvergessener Kirchenmusiker bleiben können? Ein weltberühmter Orgelimprovisator, der in Nancy, Paris und London im Klangrausch Tausende Menschen erobert. Mit über vierzig Jahren bricht er endgültig aus, um lebenslang wieder und wieder auszubrechen, auch aus dem Kirchenraum. Er findet sich und seine Sprache im weltlichen Formgelände der Sinfonie. Sinfonieskulpturen von exzessiven formalen und tonalen Dimensionen, die wie fremdartige, unverständliche Meteoriten einschlagen. Sie sind angebunden an die Tradition und blicken weit über die Horizonte zum Avantgardistischen hin. Sie erzählen keine Ich-Geschichten, sondern schlagen einen transpersonalen Raum auf. Erst mit der „Siebten“ kann er im Alter von sechzig Jahren einen ersten großen Erfolg in Leipzig und München feiern. Alles hat seine Grenzen. Nur nicht Bruckner. „Er ist jenseits“, drückt es sein Wiener Gegenspieler Johannes Brahms aus. „Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“, ist ein Ausspruch, der Bruckner in die Schuhe geschoben wird. Wenngleich dessen Urheberschaft eine Unterstellung zu sein scheint, gilt dieser schöne Satz für Bruckners Schaffen in besonderem Maße. Obendrein wird dieser Satz ebenso Aristoteles angedichtet. Für diesen Fall ist er schon gut 2.100 J a h r e vor Bruckners Geburt gefallen.
Der Zweifel feiert in unseren Tagen nicht unbedingt Hochfeste. Oft und lautstark etwas zu verkünden, reicht oft als Wahrheit aus. Etwas zu hinterfragen, heißt nicht gleich, misstrauisch durch die Welt zu gehen. So sind viele Klischees und Wahrheiten rund um Bruckner in Zweifel zu ziehen. Er war gewiss ein frommer Mann, aber kein Musikant Gottes. Er ist in seiner Ambivalenz und scheinbaren Widersprüchlichkeit schwer zu fassen.
Wer sich mit dem Menschen Bruckner befasst, muss sich auseinandersetzen, stößt auf Krisen, Zweifel und Beharrlichkeit. Dies gilt auch für die Aufführungsgeschichte seines Werks, in die sich zu oft epische Breiten, Pathos und viel Weihrauch imprägniert haben, ohne am Papier, in der Partitur wirklich manifest zu sein. Der Partitur auf der Spur zu sein, heißt in dem Sinn nichts anderes, als Fragen zu stellen. Die Antworten darauf werden nicht weniger vielfältig ausfallen, denn letztlich entscheidet die Interpretin, der Interpret, was zumindest für den Moment des Erklingens wahr ist. Bruckner beherrschte sein kompositorisches Handwerk wie wenige im 19. Jahrhundert und begriff sich im Fluss der Musikgeschichte. Seine singuläre Musik zeugt vom Blick eines Avantgarde- Schaffenden, der die Zukunft voraushört. Eine andere künstlerische Perspektive einnimmt als die meisten seiner Zeitgenossen. Was Unverständnis heraufbeschwören musste.
Faszinierend an seiner Musik ist, dass sie einem nicht entgegenkommt. Es ist Musik, die offen ist, in die und der man sich bewegen, „reingehen“ kann, durch alle Poren der Klänge eindringen kann. Es ist keine Anbiederungsmusik. Was für eine Chance unserer Tage, den Flugmodus unserer Mobiltelefone in einen Hörmodus zu transformieren und in den „Space“ der Klangwelt von Anton Bruckner ein-, vielleicht auch abzutauchen. Es ist eine Erfahrung, die mehr als nur drei Minuten Dauer garantiert, man kann sich darin gesichert für mindestens eine Stunde einfinden. Die Sinfonien dauern bis zu 90 Minuten, was für eine geschenkte Zeit! „Wo ihr unübersteigliche Schranken gesetzt sind, da beginnt das Reich der Kunst, welches das auszudrücken vermag, was allem Wissen verschlossen bleibt.
Ich beuge mich vor dem ehemaligen Unterlehrer von Windhaag“, sagt Adolf Exner, der Rektor der Wiener Universität, anlässlich der Verleihung des Ehrendoktorats an Anton Bruckner im Jahre 1891. Ich denke an „Das Lied von der Wirklichkeit“ von Georg Kreisler, in dem es heißt: „In der Wirklichkeit gibt’s nie Beweise, denn die Wirklichkeit, die ist wahr. Kommt mit mir auf eine wahre Reise voller Traum und ohne Kommentar. In der Wirklichkeit sind die Träume, die kein Physiker je beschreibt. Kommt mit mir in meine Zwischenräume, wo kein Mensch die Wahrheit übertreibt.“ Kreisler würde heuer seinen 100. Geburtstag feiern. 2024 begeht Bruckner seinen 200. Geburtstag. Zweifellos eine gute Gelegenheit, uns mit ihm und uns auseinanderzusetzen, uns in die Zwischenräume zu begeben, dort, wo Nähe und Wirklichkeit stattfinden können. Nähe. Schon die Kürze des Worts lässt kaum Raum zur Distanz. Zeiten der Unsicherheit räumen uns das Recht zum Zweifel mindestens so ein wie die Besinnung darauf. Die Kunst legt uns das Menschliche, das Mögliche nahe. Sie erinnert uns daran, sie kann uns näherbringen. Bruckner macht es uns möglich. „Fantasie ist nichts für die Experten, die das Leben fürchten und den Tod“, so Georg Kreisler und mehr als ein Grund zum Feiern!
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite