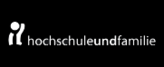Der Huchen, die Rodl und ein Tumorzellenschredder
Es begann mit dem Schutz von Fischen an der Großen Rodl – und am Ende stand ein an der JKU entwickelter Prototyp einer
Maschine, die die Metastasierung von Krebs im menschlichen Körper eindämmen könnte. Wie das eine zum anderen kam? Eine Chronologie.
In konspirativer Gesellschaft
Nichts geschieht durch Zufall. Nichts ist, wie es scheint. Und: Alles ist miteinander verbunden. Das sind die wichtigsten Ingredienzien für eine Verschwörungstheorie. In Zeiten von Corona funktionieren sie besonders gut. Auch wenn sie noch so falsch sind. Warum ist das so?


Die Reifeprüfung
Das vergangene Schuljahr endete mit kollektiver Überforderung. Wie stehen die Chancen, dass es besser wird? Karin Leitner über bildungspolitischen Katastrophenschutz.
Die neue, alte Normalität
Die Prognosen von der schönen, neuen Post-Corona-Welt erwiesen sich als heillos übertrieben. Oder zumindest als verfrüht. Ein Systemwandel ist nicht in Sicht.


Koste es, was es wolle
... zahle es, wer mag. Politische Entscheidungen in Zeiten der Corona-Krise. In der Auseinandersetzung mit den Folgen werden uns Masken nur bedingt helfen.
Fragen aus Keplers Garten
In die Zukunft denken, Innovation erkunden und zugleich mit Formen des Diskurses experimentieren: All das hat mit der DNA des Ars Electronica Festivals zu tun. In der Corona-Krise mutiert das Linzer Medienkunstfestival nun selbst zu einem Prototyp.


Die Gesellschaft ist gefordert, bevor die Dystopie zur Realität wird
COVID-19 hat gezeigt, wie unerwartet schnell die gesellschaftliche Normalität dystopische Züge annehmen kann, sei es die Staatskontrolle in China, sei es die zur Schau gestellte Verantwortungslosigkeit eines Trump oder Bolsonaro, aber auch in Europa. Mehr als zehn Jahre Austerität nach der Finanzkrise haben den Gesundheitssektor an Grenzen gebracht, an denen die Triage über selektives Überleben entscheiden sollte. Der wirtschaftliche Shutdown hat nicht nur Dividenden, sondern Existenzen einbrechen lassen. Der soziale Shutdown hat gezeigt, dass dem Beziehungswesen Mensch die digitale Welt allein nicht genügt und wie schnell demokratische Formen politischer Willensbildung gefährdet sind, wenn Machthaber* innen die Ungunst der Stunde zu weiterer Selbstermächtigung nutzen. Der kulturelle Shutdown hat nonkonformistische Künstler*innen, die nicht von der „Kulturindustrie“ (Adorno/ Horkheimer) leben, besonders getroffen. COVID-19 hat eine Idee davon vermittelt, auf welche Zivilisationskrisen sich die Gesellschaft zu bewegt, wie sozial, politisch, kulturell arm sie sein wird, wenn sie nicht umdenkt. Ein im Wortsinn radikales, an die Wurzeln des Übels heranreichendes Umdenken ist erforderlich.
Die Pandemie und weitere sozial-ökologische Gefährdungen wie der Klimawandel hängen engstens mit dem wirtschaftlichen Raubbau an den Lebensgrundlagen der Menschheit zusammen. Dieser Raubbau hat mit dem Industriekapitalismus begonnen und gefährdet im Finanzmarktkapitalismus das Überleben. Weder lassen sich Katastrophen wissenschaftlich-technologisch beherrschen, wie das moderne Fortschrittsdenken immer wieder glauben machen will, noch sind die finanzmarktkapitalistischen Wachstumsimperative mit einer nachhaltigen Lebensweise vereinbar.
Zeiten großer Wirtschaftskrisen – und nicht nur die Länder Europas sind bereits mittendrin – waren immer auch Zeiten verschärfter sozialer Ungleichheiten und tiefgehender gesellschaftlicher Spaltungen, die der Demokratie an die Substanz gegangen sind. Sie fordern zur Auseinandersetzung heraus, wie gewirtschaftet und gelebt werden kann und soll. In der Gegenwartsgesellschaft gibt es zahlreiche „reale Utopien“ (Wright) solidarischen Zusammenlebens, sozial- ökologisch nachhaltigen Wirtschaftens und deliberativer politischer Willensbildung. Sie tangieren die „kleinen Fragen“ des Alltags – vom öffentlichen Nahverkehr bis zum Mehrgenerationenhaus – ebenso wie die „großen Fragen“ von industriellem Umbau, Wirtschaftsdemokratie und Sozialstaatsentwicklung. Es geht mir nicht darum, welche Wege hier beschritten werden können und sollen, aber die Gesellschaft ist gefordert, sich damit zu befassen, bevor die Dystopie mehr und mehr zur Realität wird. Margaret Thatchers berühmter Satz in Sachen Wirtschaftsliberalismus passt, wenn die Menschheit überleben will, besser für sein Gegenteil, die Utopie einer solidarischen Gesellschaft: There is no alternative.
Wie es weitergehen kann
„Denken heißt überschreiten!“, schreibt der Philosoph Ernst Bloch in seinem Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“. Er meinte damit nicht nur das Überschreiten der von anderen gesetzten Grenzen, sondern auch das Überschreiten von selbst gesetzten Grenzen, die uns daran hindern, Möglichkeiten als realisierbare Ideen zu sehen, als Utopien, und nicht als unerreichbare Traumbilder. Bloch stellte den Begriff der Utopie in einen Zusammenhang mit dem Begriff der Hoffnung, den er als Bereitschaft zur Eroberung des Neuen sah. „Es kommt darauf an, das Hoff en zu lernen“, ermuntert uns Bloch. Hoffen kann man nur über das Bestehende hinaus; den Status quo braucht man nicht zu erhoffen.
Eine Gesellschaft, die nicht in Nostalgie ertrinken oder im Pragmatismus ersticken will, braucht die Kraft von Utopien. Kraft erlangen Utopien allerdings nur, wenn man ihnen den defätistischen Makel nimmt, das unrealisierbare Produkt weltabgewandter Traumtänzerei zu sein.
Die Abschaffung von Sklaverei und Leibeigenschaft, gleiche Rechte für Frauen und Männer, der demokratische Rechtsstaat, die Geltung der Menschenrechte, die Reise zum Mond, die Gründung der UNO und der EU ... all diese Ideen waren zu bestimmten Zeitpunkten Utopien – konkrete Utopien, weil Menschen an ihre Realisierbarkeit glaubten und dafür gekämpft haben, dass diese Utopien gesellschaftliche und politische Anerkennung erhalten und als ebenso realisierungswürdig wie realisierungsfähig angesehen werden.
Eine utopische Antwort auf die noch kaum erkennbaren Herausforderungen der beginnenden ersten industriellen Revolution war die Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Der Unterricht an den Schulen des Dampfmaschinenzeitalters konzentrierte sich übrigens nicht auf das Verständnis und die Bedienung von Dampfmaschinen.
Heute verändern die Klimakrise und eine naturwissenschaftliche/ technische Revolution wieder einmal das Leben der Menschheit. Nur viel schneller und tiefgreifender als je zuvor.
Wie können wir Arbeit, Bildung, Wirtschaft, Politik und die Rolle des Menschen im Zeitalter von Digitalisierung, Gentechnik und Quantentechnologie neu definieren, bevor sich das Zeitfenster für sozial verträgliche Gestaltungsmöglichkeiten schließt?
Der Radikalität unserer Zeit kann man nur mit der Radikalität von Utopien gerecht werden. Die Kunst kann das. Und die Wissenschaft kann das. Gemeinsam könnten sie im Bloch’schen Sinne zu Hoffnungsträgern für die Eroberung des Neuen werden. Denn die zielgerichtete Verbindung von wissenschaftlichem, technologischem und künstlerischem Denken ist ein wichtiger Ansatz, wenn nicht eine Voraussetzung, um konkret-utopische Strategien für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.


Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Jetzt ist schon wieder was passiert. Das hat er sich oft gedacht, der Breneis Simon. Also eigentlich hat er sich das fast immer gedacht. Zumindest immer dann, wenn es eine Mathematik-Prüfung gab. Das kann er nämlich. Das mit den Zahlen und dem Denken. „Wenn was mathematisch bewiesen wurde, dann hat man die absolute Sicherheit, dass es auch wahr ist.“ Das hat er einmal gesagt, der Breneis. Da hat man schon gewusst: Wenn einer so was sagt, dann wird das was werden mit der Mathematik. Und dann ist es halt auch was geworden mit der Mathematik. Weil bei jeder Prüfung was passiert ist. Was Gutes. Ganz oft. Deshalb ist der Breneis einer der jüngsten Mathematik-Master aller Zeiten an der JKU geworden. Mit gerade einmal 20 Jahren.
„Mathematik kann unheimliche Freude bringen, wenn man sie versteht, und gleichzeitig tief verzweifeln lassen, wenn man nicht mitkommt.“ Auch so was sagt der Breneis. Da spürt man dann ein bisschen, dass er verliebt ist. In das, was er tut. Und so, wie man bei der Liebe ja auch nicht weiß, warum sie einen erwischt, weiß der Breneis Simon auch nicht so genau, warum das mit der Mathematik und ihm halt so ist, wie es ist. Da kann man sich nicht wehren, sagen die Leute. Also gegen die Liebe, die fällt halt hin, wo sie hinfällt. Beim Breneis zur Mathematik. Oder bei der Mathematik zum Breneis. Das kann man sehen, wie man mag. Und wahrscheinlich ist beides richtig. Aber die Geschichte vom Simon und der Mathematik sagt auch was vom Träumen. Weil es ist ja schön, wenn man so träumt. Nur, wenn dann nix davon überbleibt, wenn man nicht mehr schläft, was ist dann so ein Traum eigentlich noch?
Gut, dass der Breneis das nicht kennen muss. Weil der lebt seinen Traum. Aber wenn man ihn so reden hört von Gleichungen, Vermutungen und Funktionen, dann spürt man, dass der Breneis noch Pläne hat. Und Träume. Vom Denken, vom Rechnen und vom Lösen großer Rätsel. Und dann hat man von einem 20-jährigen Mathematiker ganz viel gelernt. Von der Liebe, vom Glück und vom Glücklichsein. Und deshalb ist der Breneis nicht nur gescheit, sondern wirklich weise.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal schreibt Simon Breneis, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für Analysis, über die Faszination Mathematik.


Ihr seid naiv! Zeit für Eutopie
Ein Spätsommerabend, die Donau strömt wie flüssiges Silber, der Kellnerandroid stellt mit zurückhaltender Verbeugung zwei goldschimmernde Gläser Schlägl Kristall vor uns hin, denn ich bin eine liberale Autokratin, die viel Verständnis für die Bedürfnisse von Männern hat. Und trotzdem haben die Augen meines Neffen ihren Glanz verloren. War ich zu harsch mit ihm? Bestimmt. Man redet der Jugend nicht ihre Zukunftsvisionen schlecht. Ich lege meine Hand auf seine Schulter. „Wenn du es wirklich willst, kannst du natürlich BWL studieren!“ Sein Kinn zittert. „Es ist mir egal, ob das eine brotlose Kunst ist, ich will Unternehmensberater werden!“, sagt er, und es klingt nicht so trotzig, wie er denkt.
Er hat es nicht leicht als Patenkind einer Despotin. Noch dazu einer, die es gegen die Wirtschaftselite durchgesetzt hat, dass Menschen radikal nach dem gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit und ihren Möglichkeiten bezahlt werden. Da macht man sich ein Geschwader an Feinden, und Sippenhaft ist für Marvin kein Fremdwort. Aber anders hätte das Matriarchat keine Mehrheit gefunden. Bizarr eigentlich, dass wir Frauen uns Jahrtausende lang dermaßen sekkieren lassen haben! Und dass es dieser Seuche bedurfte, um die Revolution auszulösen! Was die Jungen heutzutage gern vergessen, weil es ihnen schon zu gut geht unter meiner Obhut: 85 Prozent der verlorenen Arbeitsplätze waren jene von uns Frauen! Gleichzeitig haben sich die Herren vorgestellt, dass wir zu Hause unbezahlt putzen, pflegen, kochen, unterrichten – und dann auch noch Diät halten, damit wir während des Lockdowns nicht blad werden. Darum ist es mir ungemein wichtig, dass „Frauenkolonialismus“ heute, zwanzig Jahre später, im Lehrplan aller Schulen steht. Jetzt lernt jedes Kind Gerechtigkeitsgeschichte – wenn sie hören, dass Frauen noch im 20er-Jahr 41 Prozent weniger Pension bekommen haben, reißen die Kleinen die Augen auf.
„Muss es denn unbedingt BWL sein?“, frage ich den einzigen Sohn meines Bruders, „wie so ein Betrieb geht, ist doch keine Wissenschaft.“ „Aber der Staat ist ein schlechter Wirtschafter …“, will er sagen, doch ich haue so fest auf den Tisch, dass die anderen Gästinnen sich zu uns umdrehen. „Ich bin der Staat!“ Gut, ein Totschlagargument. „Und wir sind ein stinkreiches Land!“ Marvin gibt noch nicht auf: „Es gibt so viel Sparpotenzial! Ohne Wettbewerb fehlen uns die Innovationen!“ Jetzt werde ich böse. „Schatzi, du willst mich provozieren, das ist dein gutes Recht. Aber es steht nicht ohne Grund in der österreichischen Verfassung, dass Kooperation Mittel unseres Wirtschaftens ist, WEIL ES OBJEKTIV STIMMT!“ Der ganze Gastgarten brummt zustimmend wie ein Hummelschwarm. Ich senke meine Stimme. „Wozu haben wir alles digitalisiert, wenn wir uns nicht das Leben schön machen? Lass’ die Menschen doch so arbeiten, wie es ihnen lustig ist, das geht sich alles aus!“ Er murmelt etwas von „da ginge mehr fürs BNP“, ich knurre. „Marvin, willst du an den Stammtischen der Patriarchen enden, die in ihre Biere weinen? Die greinen, dass der Markt alles regeln soll?“ Er schüttelt den Kopf, nein, zu diesen Außenseitern will er nicht gehören. Dann lächelt er endlich. „Tante Dominika, ich hab’s! Die sitzen im Abseits, weil der Markt wirklich alles regelt, drum haben sie nix mehr zu melden!“ Wir lachen beide herzlich, er ist halt doch mein schlauer Lieblingsneffe, und nein, ich bin nicht traurig, dass es in meiner Familie keine Stammhalterin gibt. Was wäre denn das für ein modriges Denken?
Oft fragen mich ausländische Journalistinnen, warum ich kapitalistische Thinktanks als Subkultur nicht nur zulasse, sondern sogar fördere. „Schauen Sie“, sage ich, „die Mittel stellt meine Männerministerin zur Verfügung, um den sozialen Frieden zu gewährleisten.“ Damit dürfen die Leistungsfetischisten ihre schlecht besuchten Hayek-Leseabende veranstalten, Lyrik über ihre Sehnsucht nach dem Neoliberalismus schreiben oder Ironman-Triathlons organisieren. Es ist wie mit Fuhrknechten oder Bergarbeitern! Wir müssen auf die Menschen schauen, besonders wenn ihre Branchen obsolet werden! Meine Position ist so gefestigt, dass sie es leicht aushält, wenn sich Marktromantiker und Kooperationsleugner daran reiben. Die Gerechtigkeitskritiker dürfen behaupten, was sie wollen, zum Beispiel den ganzen Tag, dass man wegen der politischen Korrektheit gar nichts mehr sagen darf. Sie müssen dafür nur eine Freikirche gründen, denn da geht es um persönliche Glaubensgrundsätze. Die Katholiken glauben ja auch an eine jungfräuliche Geburt, also wo fange ich bei den Privatisierungs- Esoterikern an, wenn ich das rational angehe? Und warum auch? Ich will, dass die Menschen glücklich sind. Eine Diktatorin hat Besseres zu tun, als sich in das Privatleben ihres Volkes einzumischen. Aktuell denke ich etwa an einen Matriarchats-Export in andere Länder, aber nicht militärisch, sondern durch Soft Power. Wie ich damals dem Trump den Krieg erklärt habe, persönlich natürlich, nur Schwächlinge brauchen Waffen, und ihn mit dem ersten Schwinger an sein breiiges Kinn von den X-Beinen geholt habe, das hat schon weltweit Eindruck gemacht.
So, jetzt wird es zu albern. Schluss mit diesem demokratisch fragwürdigen Tagtraum! Lassen Sie mich den verbleibenden Platz hier seriös nutzen. Ich bin keine Feindin der Wirtschaft. Wir sind ja alle Teil davon! Dieser Text bewegt sich im Kreislauf der Waren, Sie lesen ihn, ich bekomme Geld dafür. Der Kapitalismus nervt brutal, aber Sachen kaufen ist super: eine Hose, die genau so „lang“ wie meine Beine ist, neue Wanderschucherl, eine Flasche Champagner für den Mann, den ich von allen am meisten mag (das habe ich fast ohne Wettbewerb herausgefunden).
Sie wissen, eine Welt ohne ihre Ausbeutung können wir uns schwerer vorstellen als ihren Untergang, zumindest kann’s Hollywood nicht. Das Wichtigste, das ich Ihnen hier vermitteln möchte, ist mein Glaube an die Utopie. Und an den Auftrag, unsere Vorstellungskraft mindestens so zu trainieren wie unsere Bauchmuskeln! Ich bin eine große Freundin des Unwahrscheinlichen, des groß Geträumten, des schönen Lebens für alle. Das Gegenteil der faden Weltuntergangs- Dystopien ist die Eutopie, der Zukunftsoptimismus. Den brauchen wir.
Meine Mutter hat sich bis zuletzt über meine wachsende Liebe zum Bergsteigen gewundert. Vor 41 Jahren hatte sie mich besorgt zur Kinderkardiologin getragen, weil mich das Erlernen des aufrechten Ganges so gar nicht reizte. „Nein, die ist nur faul“, sagte die Ärztin. Wenn also aus einem feisten Kleinkind („Pröbstling“) eine immer noch leicht feiste, aber sehr mobile Frau werden kann, wie viel mehr kann aus der Gesellschaft werden? Warum sollte sich so wie das Wandern gegen die Trägheit nicht auch die Vernunft gegen die Ungerechtigkeit durchsetzen?
Und wie lustig ist es eigentlich, wenn Entscheidungsträger den Künstlerinnen bescheiden, ihre Visionen und Projekte seien schön und gut, aber nicht zu bezahlen – und dann selbst milliardenschwere Autobahnprojekte aushecken, für die sie Tunnel durch Granit graben lassen, Felswände sprengen, Hektoliter Beton in Flüssen versenken? Während Schulpsychologinnen und Bibliotheken und Mindestsicherungen zusammengekürzt werden wie der Giersch in meinem Garten? Wenn wir Luftmenschen von einem Milliardenkonjunkturpaket für den Sozialbereich oder ein Landeskunstschulwerk reden, lächeln die vermeintlichen Realos milde. Dabei ist es einfach nur naiv, zu glauben, wir kämen ohne Utopien aus unserem Schlamassel heraus.
Die zärtliche Welt
Ein Essay von VALERIE FRITSCH. Vorgetragen im Rahmen der langen Nacht der Utopie an der JKU.

 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite