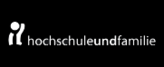Von Lausanne lernen
Die geplante Technische Universität in Oberösterreich wirft ihre Schatten voraus. An Zurufen, Wünschen und Erwartungen mangelt es nicht. Neu, neu, neu ist das Credo. Aber wie? Ein Rückblick kann auch hier den Blick nach vorne weiten.
Hypertext
Um eine Wissensgesellschaft zu bauen, müssen wir Zusammenhänge verstehen und erklären können. Darin wird Digitalisierung zu dem, was sie sein soll: ein Werkzeug von Vielfalt, Innovation und gelungenem Leben.


Zwischen Tech-Startups und Mao-Bibel
Der Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Weltmacht ist ohne sein Bildungssystem undenkbar. Doch gleichzeitig wird die akademische Freiheit an den Universitäten zunehmend beschnitten.
Sprung nach vorn
Mithilfe seiner hierarchischen und prüfungsorientierten Universitäten will China zur einzig führenden Weltmacht werden. Kritische Intellektuelle sind dabei nicht gefragt.


Der Schweizer Tech-Olymp
Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und ihre kleine Schwester in der Romandie, die École Polytechnique Fédérale de Lausanne, zählen zu den renommiertesten Hochschulen der Welt. Wie machen die Schweizer das?
Demokratie braucht Drama
Wie kann unsere Gesellschaft in Zukunft bestehen? Bildung war und ist unser Aufstiegsversprechen, sagt der ehemalige Kanzler Wolfgang Schüssel. Jede Investition in Bildung würde sich mehrfach rechnen.


Eine kleine Geschichte des Scheiterns
Die Gründung einer Universität ist immer kompliziert und oft kann dabei was schiefgehen. Um das zu belegen, muss man gar nicht erst zu den Anfängen der Universitäten im Mittelalter zurückschauen. Aber man kann.
Digitale Identität in Linz
„Linz. Stadt im Glück“ hieß 2009 eine Ausstellung in der damaligen Kulturhauptstadt Europas, die von einem Forscher*innenteam rund um Thomas Philipp (LIquA - Linzer Institut für qualitative Analysen) konzipiert und von der Multimediafirma checkpointmedia, die ich 2001 mitbegründet habe, umgesetzt wurde.
Die Ausstellung beschäftigte sich mit den (damals) vergangenen 30 Jahren und dem radikalen Wandel der Identität, den Linz durchlaufen hatte. Lange davor musste die Stadt gegen ihr negatives Image kämpfen, viele Jahre stand sie als smogproduzierende Industriestadt in Verruf, und der Schatten jener Zeit, als sie die Patenstadt des „Führers“ war, reichte und reicht bis in die Gegenwart.
Doch dann begann, begleitet von Kunstuniversität, der Ars Electronica und der Freien Szene, die Transformation von einer „Industriestadt“ zu einer „Industrie- und Kulturstadt“. Kultur wurde dabei nicht als zusätzliches Freizeitangebot oder Luxus für die Elite begriffen, den man sich in guten Zeiten zur Zerstreuung leistet, sondern als integraler Bestandteil und Netzwerk des täglichen Lebens, dem es damit auch möglich war, in unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft zurückzuwirken. So wurde etwa die Stadtplanung beeinflusst, die mit der Erforschung und Etablierung von kreativen Milieus begann (z.B. Tabakfabrik), oder auch ein Konzern wie die Voestalpine, der sich heute nicht mit rauchenden Schornsteinen, sondern fast wie ein kreatives und flexibles IT-Start-up digital präsentiert.
Man erkannte: Glück ist nicht nur Zufall wie ein Lottogewinn, sondern auch ein – wenn auch fragiler – Zustand, der mit gemeinsamer (Kultur-) Arbeit hergestellt werden kann. Seit 2009 ist die digitale Entwicklung und die Vernetzung von Hard- und Software rasant vorangeschritten. Wurden zunächst analoge Informationen oder Abläufe mehr oder weniger eins zu eins digital abgebildet, so werden nun ganze Arbeitsprozesse entweder umgestellt oder abgeschafft oder überhaupt völlig neu gedacht und digital abgebildet, was auch – in beide Richtungen – massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Gegenwart und Zukunft hat.
Die Möglichkeit und die gesellschaftliche Notwendigkeit, in derartige Überlegungen auch künstlerische Strategien zu integrieren und anstatt mit simplem „Ja/Nein“ auch mit Feldern von Möglichkeit und Ungewissheit leben und arbeiten zu können, haben sich damit noch einmal erweitert. Gerade in dieser Zeit sollte Linz verstärkt auf die so gelungene und erprobte Kollaboration von Kunst und Industrie setzen.
Link zur Ausstellung: https://liqua.net/stadt-im-glueck/


Digitale Identität aus Linz
Wie nur wenige Orte (insbesondere in Europa) kann Linz tatsächlich von sich behaupten, vom „Digitalen Wandel“ nicht nur betroffen zu sein, sondern auch einen Beitrag dazu geliefert zu haben bzw. zu liefern und das nicht nur durch einige beachtliche Success-Stories von Start-ups oder erfolgreich international agierenden Software-Firmen, sondern, weitaus einzigartiger, auf dem Sektor der kulturellen und sozialen Bedeutung der digitalen Technologie. 1979 fand zum ersten Mal das Ars Electronica Festival statt und bereits damals wurde es explizit als Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft bezeichnet. Erdacht von einem Journalisten, einem Künstler und einem Wissenschaftler, war es bereits damals ein Prototyp für jene Interdisziplinarität, in die wir heute so große Erwartungen setzen, für die Bewältigung der großen Herausforderung, die digitale Revolution mitgestalten und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Dahinter stand die Idee, dass es möglich sein würde, durch eine vom künstlerischen Denken und Agieren inspirierte Reflexion die Transformationskräfte, die von dieser neuen Technologie auf Kultur und Gesellschaft zu erwarten waren, besser zu verstehen und ihr eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Ausrichtung zu geben. Eine Vision, die auch als Leitbild für die Transformation der Stahlstadt Linz zur modernen Technologie- und Kulturstadt große Bedeutung erlangen sollte.
Im Vorwort des ersten Festivalkatalogs schrieb man vor 41 Jahren: „Mit der Elektronik ist ein progressives Element in unsere technische Welt gekommen, dessen Einfluss sich nicht auf Industrie und Forschung beschränkt, sondern in alle Lebensbereiche eingreift. Damit ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die erstaunliche und phantastische Aspekte eröffnet, in anderen Belangen aber auch Kritik und Skepsis hervorruft.“
Ja, eigentlich müsste man nur das Wort Elektronik durch Digitalisierung oder noch aktueller durch Künstliche Intelligenz auswechseln und schonwäre es das perfekte Statement für die Ankündigung einer neuen Universität für Digitalisierung und Digitale Transformation.
Die Notwendigkeit einer durch Kunst und die menschlichen und gesellschaftlichen Perspektiven geprägten Sichtweise auf die Potenziale der Digitalisierung ist in unseren Tagen um nichts geringer geworden – ganz im Gegenteil. Die Fähigkeit, Digitalisierung über ihre technologischen Aspekte hinaus als kulturelles Projekt zu sehen, ist auch der Schlüssel für die große Chance Europas auf eine erfolgreiche Positionierung im globalen Wettbewerb der datenbasierten digitalen Produkte und Dienstleistungen: Durch eine „Veredelung des Rohstoff s Daten“, durch die Entwicklung und Gestaltung von digitalen Anwendungen und Wertschöpfungen, die unseren ethischen und moralischen Standards standhalten können und die das Vertrauen der Nutzer*innen und Konsument*innen verdienen. Ein Vertrauen, ohne das eine digitale Gesellschaft und Wirtschaft nicht prosperieren können und das als Basis eines europäischen Wegs, eines „digitalen Humanismus“, zukunftsweisend sein kann.
Die dafür zusätzlich notwendigen Kompetenzen und Expertisen, obwohl wir sie vielfach im Detail noch gar nicht kennen, muss eine Universität des 21. Jahrhunderts abdecken können.
- Sie muss selbst die Lernfähigkeit und Adaptionsfähigkeit haben, den ständig neu hinzukommenden Ausprägungen der Digitalen Transformation folgen zu können.
- Sie muss die Frei- und Spielräume haben, um in der Dynamik der Entwicklung navigieren und führen zu können.
- Und sie muss die Offenheit und Kreativität haben, um die Auswirkungen und Konsequenzen dieser Entwicklungen antizipieren und mitgestalten zu können.
Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Von 1993 bis 2002 haben Dana Scully und Fox Mulder die Wahrheit da draußen gesucht: „The Truth is out there“, hieß es. Seit 2010 sucht Martina Seidl, Professorin für Künstliche Intelligenz an der Johannes Kepler Universität Linz, ebenfalls nach der Wahrheit. Oder vielmehr nach dem, was wahr und was falsch ist. „Meine Forschung beschäftigt sich mit der schnellen Auswertung von logischen Formeln. Mit diesen Formeln kann man Regeln ausdrücken, die eine Künstliche Intelligenz befolgen muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen“, erklärt Martina Seidl, womit sie sich den ganzen Tag und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit so beschäftigt. Nicht selten kommt sie sich dabei wie die beiden Akte-X-Agenten vor.
Denn das Denken um Ecken und das Lösen hochkomplexer Aufgaben sind die Herausforderungen, die sie seit Jahren begleiten. „Eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die Korrektheit von Solvern, also den Programmen, welche logische Formeln auswerten. Wenn ein Solver dazu verwendet wird, um zu verifizieren, ob ein anderes Programm korrekt ist, muss man sich darauf verlassen können, dass dieser selbst korrekt ist. Allerdings ist ein Solver meist so komplex, dass dieser selbst nicht verifiziert werden kann, und daher muss man sich andere Verfahren überlegen, um sicher zu sein, dass das gefundene Resultat stimmt. Konkret setze ich hierzu Techniken aus der Beweistheorie ein.“ Wahr, richtig, bewiesen. Es sind große Worte, die die Forschung und das Arbeiten von Martina Seidl prägen. Aber so wie der Mensch die Arbeit prägt, so prägt die Arbeit auch den Menschen. Rätsel und Herausforderungen gibt es im Leben der jungen Professorin genug. Vor allem, seit ihre neun Monate alte Tochter immer wieder die Wahrheit und die Richtigkeit der elterlichen Vorstellungen auf harte Proben stellt. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen hält sich Martina Seidl aber nicht so sehr an X-Akten, sondern lieber an einen anderen Detektiv – an jenen Mann, der in anderen Bereichen eine neue Form der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung erdacht hat. Eines der bekanntesten Zitate, das Sir Arthur Conan Doyle seiner Figur Sherlock Holmes in den Mund gelegt hat, lautet nämlich: „Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.“
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal schreibt Martina Seidl, Professorin für Künstliche Intelligenz, über das Denken um Ecken und das Lösen von komplexen Aufgaben.


Ich bin der Stau
Vor einigen Jahren appellierte meine kleine Tochter an mich: „Papa, du bist ein Wahnsinn. Kannst du wieder einmal ein bisschen normal werden?“ Welche Erfahrung die Vierjährige gemacht hat, um auf einmal zu bemerken, dass ich nicht normal bin, weiß ich nicht. Ich vermeide bewusst den Konjunktiv.
Außer der Norm war ich schon als Achtjähriger, als ich Tag und Nacht die „Vierte“ von Bruckner gehört habe. Als Musikerkind greift man eben früh nach Flöte und Schallplatten – wie ein Spross eines Tischlerhaushalts vermutlich nach Hobel und Pressspanplatte. Mein Bruder ist übrigens doch Tischler geworden. Er wusste dies schon im zarten Kindergartenalter und hat nie wieder an seiner Berufswahl gerüttelt. Das Abnormale bemerken wir erst, wenn sich etwas vom Gewohnten, Üblichen zu unterscheiden beginnt. Abweichung weckt Irritation, Sehnsucht oder Neugier. In den meisten Fällen bringt sie Möglichkeiten mit sich, die mitunter gerade noch unmöglich schienen.
Unser pandemischer Ausnahmezustand zwingt uns, mit vielem anders umzugehen, als wir es gewohnt waren. Zeit, du bist ein Wahnsinn. Kannst du wieder einmal ein bisschen normal werden, zitiere ich sinngemäß meine Tochter weiter. Wobei die Frage ist, wie lange etwas dauern muss, um als Ausnahme durchzugehen, und nicht doch schon längst wieder zur Normalität geworden ist. Diese wird uns dann als neue Normalität verkauft. N. N. bedeutet normalerweise Nomen nescio, Nullum nomen, Nomen nominandum bzw. Numerius negidius, was in etwa meint, dass ein Name bekannter- oder unbekannterweise nicht oder noch nicht genannt wird oder werden kann. Danken Sie dieses Wissen nicht mir oder meiner verehrten Latein-Professorin, sondern Wikipedia. Es lebe das im Netz verifizierte Halbwissen.
Wir brauchen die Norm als Geländer, um uns orientieren zu können. Sie wird damit zu einer stillen Vereinbarung, deren Zustimmung gar nicht erst eingeholt werden muss. Insofern könnte man das Normale als kulturelle Übereinkunft betrachten. Ausgerechnet auf einem Geländer, das vor der profanierten Linzer Kapuzinerkirche die Fußgehenden vor dem Autoverkehr schützt, habe ich den Satz entdeckt: „Du bist der Stau.“ Während ich auf das Einfädeln in die Hopfengasse warten musste, nahm ich diese Ansage im Auto sitzend wahr. Alle heimischen Autofahrerinnen und -fahrer kennen diesen neuralgischen Punkt im Linzer Verkehrsgeschehen. Wenn man endlich drankommt, ist es immer wieder ein kleiner Kick, ob man es im kleinen Zeitfenster schafft, sich Richtung Römerbergtunnel einzugliedern. Unbeschwertes Vorankommen passiert woanders, wobei die Chancen auf Verkehrsbehinderungen in Linz generell nicht so schlecht stehen. Aber dies will hier nicht weiter Thema werden. Du bist der Stau, wird einem hier auf den Kopf zugesagt. Noch dazu ist der Blickwinkel so gewählt, dass dies nur aus dem stehenden Auto zu lesen ist.
Als Lehrer, der ich drei Jahrzehnte sein durfte, war ich immer auf der Lauer, solche Situationen herbeizuführen. Man legt einen zufälligen Stolperstein, bastelt eine Engstelle, an der die Schülerin, der Schüler vorbeimuss, und dadurch etwas erfährt, was obendrein und nebenbei noch unverständlich benannt wird. Wie wir alle wissen, lernen wir am besten durch Erfahrung. – Oder auch nicht, wenn die oberste Prämisse ist, an der – weiß ich wie alten – Normalität festzuhalten.
Wenn die Erfahrung dann gleich noch in einem klaren theoretischen Überbau – wie einem einfachen Satz – bewusst vertieft wird, könnte man dies als Beispiel formvollendeter Pädagogik anführen und zeigen, wie sehr sich Theorie und Praxis bedingen. Pädagogik ist die Kunst des gut argumentierten Fallenstellens. Mitten im Stau wird mir bewusst, dass ich es bin und nicht die Anderen. Würde ich aufs Auto verzichten, stünde ich nicht nur mittendrin, sondern würde einen Beitrag zur Entspannung des Verkehrs an dieser Stelle leisten. Die Würde gehört dem Indikativ, nicht dem Konjunktiv und Eigenverantwortung ist nicht das Gegenteil von Verantwortung. Sobald wir in die eigene Verantwortung gehen, nach eigenen Antworten suchen, finden wir sie auch für unsere Mitmenschen. Wobei am gleichen Strang zu ziehen noch gar nichts heißt, wie der große Helmut Qualtinger schon wusste: „Auch Henker und Gehenkter tun das.“
Ein Stau kann viele Gründe haben und entsteht nie aus dem Nichts. Meist sind die Verursachenden gar nicht ins Staugeschehen verwickelt, sie lösen nur aus, was zu einer Kettenreaktion führt. Damit fehlt oft der Lerneffekt für die Aus- und Leidtragenden, die sich einem unüberlegten und teilweise gefährlichen Fahrverhalten anpassen müssen, um selbst sicher weiterfahren zu können. Menschen machen einfach zu viele Fehler. Sie fahren zu dicht auf, sind einen Moment lang unaufmerksam und müssen dann scharf bremsen, was ein Stauauslöser sein kann. Aufmerksamkeit ist ein großes Thema. Sind Sie schon einmal in Rom Auto gefahren? Würde man ins römische Verkehrsgeschehen nur Autofahrende österreichischer Art und Gewohnheit verpflanzen, würde es permanent krachen. Wir sind viel zu lahm in unserer Reaktionszeit. Nebenbei bemerkt, geht dort nicht gleich die Welt unter, wenn es doch einmal zu einem Kratzer durch Kontaktnahme kommt. Der Stoßstange werden nicht nur ästhetische Qualitäten, sondern auch eine abfedernde Funktion zugemutet.
Ganz anders geht es im Tierreich zu, für Ameisen ist zum Beispiel das sichere und stetige Vorankommen aller Verkehrsteilnehmenden das Ziel. In der Forschung beobachtet man Tierschwärme, um herauszufinden, wie der Verkehr effektiver gestaltet werden kann. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass Ameisen selbstlos sind. Sie orientieren sich an den Langsamen, wer stehen bleiben muss, tritt zur Seite. Ist Selbstlosigkeit gar ein guter Ansatz hin zur Eigenverantwortung? An der Wortoberfläche würde man dies auf den ersten Blick gar nicht vermuten. Speed kills Eigenverantwortung.
Wir erleben eine sehr fragile Zeit und müssen als Gesellschaft aufpassen, dass die Risse, Gräben und Unterschiede nicht immer noch größer werden. Unsicherheit ist aber immer die große Zeit der Möglichkeiten, auch jener, uns wieder als Gestaltungsbefähigte mit Verantwortlichkeitsveranlagung – man könnte auch Empathie sagen – zu begreifen. Jede, jeder hat Einfluss und es ist höchste Zeit, diesen in Anspruch zu nehmen. Wer es nicht tut, stimmt dem Lautesten zu. Wir können bis zum Sankt Nimmerleinstag diskutieren, ob diese oder jene Maßnahme hilft, oder jene nicht. Nur um nicht missverstanden zu werden, ich finde einen fundierten Diskurs unentbehrlich. Dieser sollte auf wissenschaftlicher Basis, mit Vernunft und Mitgefühl passieren. Was ich vermisse, ist, dass wir vieles nicht mehr bereit sind zu tun, wenn es nicht unser ureigenes, unmittelbares Hoheitsgebiet betrifft. In allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen höre ich seit Jahrzehnten, da könne man nichts tun, dahinter stecken Weltkonzerne, der Chef, die falsche Partei, das rechte Netzwerk, der linke Nachbar oder das schlechte Wetter. Stimmt, gegen das Wetter sind wir machtlos, können aber zu Hause bleiben, wenn es zu stark regnet. Es ist doch gut, wenn man ein Dach über dem Kopf haben darf. Was für viele Menschen gar nicht selbstverständlich ist.
Wir können immer etwas ändern, und wenn es nur für uns ist. Gibt es eigentlich eine radikalere Veränderung als eine selbstverursachte, die einen selbst betrifft? „Wenn ich auch nur im Geringsten dafür verantwortlich bin, dass Menschen in ihrem Inneren mehr Persönlichkeiten entdecken, als sie ursprünglich vermuteten, dann bin ich zufrieden“, sagte David Bowie im Gespräch mit Alan Yentob im Dokumentarfilm „Cracked Actor“ (1975). Ich bin der Stau, ich bin die zweite Welle, ich bin das Klima, ich bin Gesellschaft, ich bin Welt. Die Inanspruchnahme von Verantwortung erfordert nicht immer sofort Heldenmut. Ich bewundere Menschen, die ihr Leben für eine kollektive Sache einsetzen. Dafür bin ich viel zu feig. Es gibt so viele Möglichkeiten, bevor man sein Leben aufs Spiel setzt. Sitzen bleiben ist keine und manchmal doch eine. Das ist Freiheit.
Das dumme Fleiß der Winkekatzen
An einem Tag, an dem sehr viel konzentriert zu schreiben ist, fahre ich handlungsbereit ins Büro. Als ich die Garage öffne, fallen mein Blick und das Tageslicht auf eine dieser solarbetriebenen Winkekatzen, die dienstfertig ihren Daseinszweck erfüllt. Meine Schwester, mit der ich das Haus wechselweise bewohne wie Sonne und Mond den Himmel, möchte die seltsame Apparatur auf der Hutablage befestigen, damit sie Geld und Glück hereinwinke, aber vor lauter Arbeit kommt sie nicht dazu.
Ich versuche, ohne Ablenkung in mein Bürobaumhaus zu steigen, um diesen Text hier zu schreiben. In den vergangenen zwölf Jahren meines Home-Office habe ich das Konzept von Scheuklappen zu verstehen gelernt. Denn der Haushalt hascht mit minder wichtigen Aufgaben nach meiner Aufmerksamkeit. Noch schaffe ich es über den Rasen, der schon aussieht wie unsere Frisuren kurz nach dem Lockdown, und ich schaffe es die Leiter hinauf – aber drinnen liegen sieben Staubflankerl, sodass ich gleich einem Putzanfall erliege, nachdem ich dann auch Hunger bekommen und gekocht habe, ist es auch schon wurscht, und ich mähe den Rasen. Gibt es so etwas wie Alters-ADHS?!
Zu meinem Erbe gehört nicht nur ein alterndes Haus, sondern ein Mühlviertler Arbeitsethos, das in den Früchten sitzender Denkarbeit keine ordentliche Ernte sieht. Um diesen skurrilen Selbstboykott zu überwinden, bräuchte ich eine zweite Meindl, der ich zufrieden dabei zusehen könnte, wie sie mir die Frackhemden bügelt und den Giersch aus dem Garten rupft. Und ich selbst, das Original, könnte endlich schreiben! Oder nur ganz schnell auf Facebook nachschauen, ob das Posting mit dem Hunderl … und auf Instagram … Als Kompromiss öffne ich meine drei Mail-Accounts und mache mich an die Administration meines Erwerbslebens, also höflich Honorare einfordern, Kollegen Links für die diversen Härtefallfonds googeln, Sitzungsprotokolle korrigieren, der Kulturdirektion Anregungen für ein Kulturkonjunkturpaket aufdrängen. Fürs konzentrierte Schreiben ist es schon lange zu spät, morgen geht’s bestimmt locker, da ist ja dann auch der Rasen gemäht! In der Garage winkt die Katze weiter mit sinnloser Tüchtigkeit. Kann dieser alte Fleiß – so etwas wie das Korsett im Leben meiner Vorfahren – nicht langsam weg wie die hölzernen Rechen, Sensen und Dreschflegel in der Gartenhütte? Wenn sie ihm lustig sei, dann sei es keine Arbeit mehr: ein Zitat meines Großvaters. Fleiß ist kein Wert an sich. Bei der Fahrt in die Kletterhalle überfällt mich schlechtes Gewissen. Wieder nichts fürs OEuvre weitergebracht! So ein leistungsarmes Leben kann sich nur leisten, wer geerbt hat! Im Ernst, was ist los mit mir? Wenn das so weitergeht, bin ich ersatzlos durch einen Schreib-Bot zu ersetzen. Weil ich gestern Zeitung gelesen habe, statt zu schreiben, weiß ich heute leider, dass laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Maschinen und Algorithmen bald jeden vierten Job übernehmen könnten. Wir Autorinnen sollten uns nicht sicher fühlen, es ist ziemlich unheimlich, wie gut digitale Schreibprogramme mittlerweile unsere poetische Arbeit imitieren. Versuchen Sie es selbst einmal mit dem „artikelschreiber.com“. Das kann man amüsant finden – oder beängstigend. Vom Zeitfaktor sollte ich gar nicht reden. Zwischen dem Auftrag für diesen Text und seiner Endfassung liegen sechs Wochen, dabei hätte ich mich in dieser Zeit nur ein einziges Mal für ein paar Stunden hinsetzen müssen. Chat-Programmen hingegen baut man eine kleine Verzögerung bei ihren automatischen Antworten ein, damit der fragende Mensch nicht durch übermenschliche Schnelligkeit erschrickt. Möglich, dass „Roboterliteratur“ bald die Science-Fiction verlässt und die Belletristik erobert. Gut, dann könnte ich den ganzen Tag im Garten kramen wie ein hyperaktives Eichkätzchen, aber ohne bedingungsloses Grundeinkommen käme ich nicht einmal durch den ersten Winter. Und es wäre auch eine moralisch sinnlose Existenz.
Während des Trainings wäge ich ab, ob es nicht klüger wäre, mich durch eine intelligente und vor allem tüchtige Androidin meiner selbst zu ersetzen, dann könnte ich seelisch ungestört bouldern, während sie meinen Roman über die chinesische Kopie von Hallstatt fertig schreibt, natürlich anhand von Big-Data-Algorithmen, nach denen ein garantierter Bestseller funktioniert.
Später, auf der Couch des Mannes, den ich von allen am liebsten besuche, denke ich – verursacht durch ein Glas Rotwein – emsig nach. Muße muss man sich leisten können. Disziplinlosigkeit ist ein Privileg. Während ich launige Facebook-Postings über Prokrastination im Home-Office schreibe, brennt sieben Häuser weiter eine rumänische Pflegerin aus, weil sie sich um eine verängstigte demente Frau kümmert, die ihr keine ruhige Minute lässt. Schön, wenn die Digitalisierung eintönige und anstrengende Arbeiten übernimmt, aber was machen die Leute, die bislang damit ihr Existenzminimum verdient haben? Wer Automaten und Algorithmen nicht für die Befreiung der Menschen hackeln lässt, soll sich in einer ruhigen Minute fragen, ob er ein profitgieriges Miststück ist. Pardon, das war zu grob, zu plakativ! Es liegt am zweiten Glas Rotwein, da geht’s mit mir durch. Ich komme sehr gut damit klar, dass mit meiner Berufswahl ein bohèmehaftes Leben einhergeht, Klagen über Honorare gehören im Literaturbetrieb zum guten Ton. Aber mich ärgert, dass wir in einem stinkreichen Land fast 300.000 „working poor“ haben, und die Pandemie wird diese Zahl bestimmt nicht senken. Es zipft mich enorm an, dass Frauen, die ihr Leben lang die eigenen Bedürfnisse hinter die der Familie gestellt haben, sich mit einer lachhaften Pension durchfretten müssen. Es nervt exorbitant, dass Schulpsychologinnen und Sozialarbeiter eingespart werden. Und gibt es einen vernünftigen Grund, warum Kindergartenpädagoginnen so mies bezahlt werden? Konzernführer und Wirtschaftsminister und Industriellenvereinigungspräsidenten (ich gendere hier nicht) lassen sich offensichtlich vom Wachstum der Wirtschaft so ablenken wie ich mich von jenem meines Rasens. Die Frage, was wir mit der frei werdenden menschlichen Arbeitskraft anstellen, ist wohl auf morgen verschoben. Offensichtlich ist es wichtiger, dass nur bloß niemand in der sozialen Hängematte lungert. Leistung muss sich lohnen! Da fällt mir wieder der dumme Fleiß der Winkekatze ein. Faulheit kann man den Maschinen nun wirklich nicht vorwerfen.
Hier mein Vorschlag zur Güte, ganz ohne Big-Data-Analyse über gelingendes Menschsein: Alle, die noch physisch arbeiten müssen, sollen flugs wohlhabend und hoch angesehen werden. Alle, deren Arbeit wegfällt, sollen sich flugs und bestbezahlt um andere Menschen kümmern. Wenn die Automatisierung nicht dazu dient, dass ALLE an den Segnungen der Arbeitserleichterung teilhaben, ist das nicht meine digitale Revolution. Den Entscheidungsträger, der mir widerspricht und panisch „Diktatur! Maschinensteuer!“ greint, lade ich zu einem Besuch in eine städtische NMS oder in ein Bezirksaltenheim oder auf ein Spargelfeld ein. Und wenn er dann noch glaubt, dass die Wirtschaft die Arbeitsplätze schafft und nicht die Menschen selbst, dann haue ich mit kletterhallenstarker Faust auf den Tisch.
Auch am nächsten Arbeitstag, am Tag der Deadline für diesen Text, winkt mir die Katze zu, als ich voller Tatendrang ankomme, und sie winkt mir zu, als ich am Abend Richtung Kletterhalle wegfahre, nachdem ich schon wieder nicht mehr als ein paar Notizen hingekriegt habe, weil sich überraschend Besuch eingestellt hat. Aber einen Tag so zu vertändeln – das soll mir ein Roboter einmal nachmachen!


Der Huchen, die Rodl und ein Tumorzellenschredder
Es begann mit dem Schutz von Fischen an der Großen Rodl – und am Ende stand ein an der JKU entwickelter Prototyp einer
Maschine, die die Metastasierung von Krebs im menschlichen Körper eindämmen könnte. Wie das eine zum anderen kam? Eine Chronologie.
In konspirativer Gesellschaft
Nichts geschieht durch Zufall. Nichts ist, wie es scheint. Und: Alles ist miteinander verbunden. Das sind die wichtigsten Ingredienzien für eine Verschwörungstheorie. In Zeiten von Corona funktionieren sie besonders gut. Auch wenn sie noch so falsch sind. Warum ist das so?


Die Reifeprüfung
Das vergangene Schuljahr endete mit kollektiver Überforderung. Wie stehen die Chancen, dass es besser wird? Karin Leitner über bildungspolitischen Katastrophenschutz.
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite