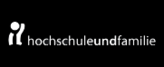Meine Blase, deine Blase
Was ist wichtiger? Die persönliche Freiheit des Einzelnen oder doch das Zusammenleben einer funktionierenden Gesellschaft? Die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung haben diese zentrale Frage eines modernen Staates wieder einmal ins Zentrum gerückt. Jede Antwort darauf sorgt aber für neue Probleme. Verdammt. Ein Essay von Cathrin Kahlweit.
„Irgendwann verzerrt die Ungleichheit die Demokratie“
Der Historiker, Philosoph und Bestsellerautor Philipp Blom im Gespräch mit JKU Rektor und Tribune-Herausgeber Meinhard Lukas über mögliche Lehren aus der Corona-Krise und warum off ene Gesellschaften etwas Schwieriges und Lästiges sind – und trotzdem das Beste, das wir haben.


Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Woraus besteht alles? Also das Leben, das Universum und der Rest? Im alten Griechenland glaubte man, alles, das existiert, setzt sich aus kleinen, unteilbaren Grundbausteinen, den Atomen, zusammen. Heute weiß man: Auch Atome besitzen einen Kern und eine Hülle, Protonen und Neutronen, die wiederum aus Quarks bestehen … Alles nicht so einfach, mit dem Leben und dem Universum. Das weiß auch Richard Küng, Assistenzprofessor für Quanteninformatik an der JKU. Zu erklären, was er den ganzen Tag macht, ist genauso kompliziert, wie ein Atom zu zerlegen: Wenn man glaubt, man hat die einzelnen Bestandteile verstanden, findet man doch ein weiteres Elementarteilchen.
„Drei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.“ – Für Küng müsste Goethes berühmtes Faust-Zitat abgewandelt werden, denn er ist gleichzeitig Informatiker, Physiker und Mathematiker. Seine Arbeit teilt sich nicht in verschiedene Disziplinen auf, sondern passiert in dem Spannungsfeld zwischen ihnen: Er beschäftigt sich mit Quantenalgorithmen. Und das ist wirklich eine komplexe Sache. Herkömmliche Computer arbeiten mit einem Dualsystem. Entweder es fließt Strom oder es fließt kein Strom. Ein Wert ist 0 oder 1. Die Quantentheorie aber, wie sie etwa bei Quantencomputern zum Einsatz kommt, beschreibt keine vordefinierten Zustände. Das Ergebnis kann 0 oder 1 sein, X oder Y. Die Werte werden erst fixiert, wenn sie gemessen werden. Alles, was wir davor über sie wissen und berechnen können, sind Wahrscheinlichkeiten. Das ist für Richard Küng ziemlich aufregend – weil das die Welt viel komplexer und weniger vorhersehbar macht, aber in diesen Zwischenräumen auch Spannendes passieren kann. „Quantencomputer sind nicht die nächste Generation an Computern. Sie sind ein anderer, zukunftsweisender Weg, um riesige Simulationen durchzuführen – oder Simulationen extrem kleiner Systeme. Es ist mir wichtig, nicht nur über die Entwicklung von Technologien nachzudenken, sondern auch darüber, wie sie eingesetzt werden und allen einen Vorteil bringen kann.“ Gerade deshalb ist Richard Küng nicht nur ein Wissenschaftler, der vom Großen träumt und dabei bis ins Kleinste denkt. Er ist auch ein Weltverbesserer, der weiß, dass es manchmal keine klaren Antworten gibt und dass das wirklich Aufregende vielleicht genau zwischen 0 und 1 passiert.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal spricht Richard Küng, Assistenzprofessor für Quanteninformatik, über seine Arbeit am Quantencomputer und das Spannende an Wahrscheinlichkeiten.
Die neue Wut, der neue Zweifel, die neue Solidarität?
Viele sagen ja, dass die Corona-Pandemie nur eine Übung ist, ein fire drill für die Klimakrise, vor der Wissenschaftler* innen seit Jahrzehnten warnen. Die Corona- und die Klimakrise sind in vielerlei Hinsicht eng miteinander verwoben. Sie sind verursacht durch ein extraktives Wirtschaftsmodell, in das die Ausbeutung von Mensch und Natur nicht eingepreist ist. Sie münden in eine immer größer werdende Ungleichheit, in der sich ausgerechnet die Profiteure dieses Wirtschaftsmodells am ehesten vor seinen destruktiven Folgen retten können. Und sie werden ähnlich bearbeitet: Gefüttert von Falschinformationen einflussreicher libertärer Lobbygruppen wie dem „American Institute for Economic Research“, welches die umstrittene „Great Barrington Declaration“ mit ihrer wissenschaftlich zweifelhaften Idee der natürlichen Herdenimmunität unterstützt hat und auch regelmäßig den Klimawandel leugnet, wenden sich „Wutbürger* innen“ und „Querdenker*innen“ gegen Wissenschaft und Politik. Die Politik selbst ist angesichts dieser Spaltung zunehmend verunsichert, handelt halbherzig und eigentlich immer zu spät. Nicht umsonst spricht der Zeit-Redakteur Bernd Ulrich von einer pandemischen Phase, in die die Menschheit schlittert: Selbst eine Impfung wird uns nicht retten.
Wie jede Krise eröffnet auch die Corona-Krise die Möglichkeit eines grundlegenden Wandels. Waren am Anfang der Pandemie noch die Hoffnungen groß, dass die Krise zum Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und fairer Bezahlung genutzt werden würde, so wachsen jetzt die Zweifel an der Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten, an supranationalen Institutionen und an der solidarischen Haltung jedes Einzelnen. Zu offensichtlich werden die Missstände und Prioritäten: Shoppen, Skifahren, „Schau auf mich“ statt „Schau auf dich“. Blicken wir hundert Jahre zurück, so sehen wir, dass die Weltwirtschaftskrise in den USA zwar den Roosevelt’schen „New Deal“ hervorgebracht hat, in Europa aber den Faschismus und den Nationalsozialismus. Und heute?
Für einen „Green New Deal“ braucht es eine starke Staatengemeinschaft, die sich traut, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ihren Bürger*innen etwas zuzumuten. Doch genau das wird von den „Wutbürger*innen“ von rechts und den neuen „Querdenker* innen“, die eher aus dem links-alternativen Milieu kommen, aber, wie eine Erhebung des Baseler Soziologen Oliver Nachtwey zeigt, eine offene rechte Flanke haben, abgelehnt. Unter diesen Gruppierungen formt sich eine neue Solidarität des Dagegenseins, für die aktuell das Maskenverweigern zum gemeinsamen Symbol geworden ist. Eine gefährliche Melange, die Nachtwey als erste „postmoderne Bewegung“ bezeichnet: Statt Wissenschaft zählen Fake News, alternative Fakten und Intuition. Dabei gibt es kaum inhaltliche Kohärenz; gemeinsam bleibt die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie, der Medien und der etablierten Wissenschaft.
Paradoxerweise wird durch dieses Chaos das Entstehen autoritärer Regime, vor denen „Querdenker*innen“ und „Wutbürger*innen“ selbst so laut warnen, nur umso wahrscheinlicher. Liegt hierin die Basis für eine positive Wendung, für eine neue Solidarität? Wir müssen es, im Hinblick auf die beiden historischen Alternativen, dringend versuchen. Die Politik muss ihren Beitrag leisten, sich von der Postdemokratie der Partikularinteressen ab- und dem Gemeinwohl wieder zuwenden, Wert- über Zweckrationalität stellen. Die Bürger*innen hingegen müssen sich darauf einlassen, dass die Freiheit ihre Grenzen haben muss. Die Redefreiheit hört bei der Lüge auf. Wissenschaftliche Erkenntnisse – deren Limitationen im Sinne einer guten wissenschaftlichen Praxis inhärent sind und transparent mitdiskutiert werden – dürfen nicht durch Meinungen und Gefühle ersetzt werden. Was der Ökologe Garrett Hardin bereits 1968 als Tragik der Allmende erkannt hat, ist heute nach wie vor gültig: „Freedom in a commons brings ruin to all.“ In einer Welt, in der alles verhandelbar und relativ ist, kann es kaum eine andere Solidarität als die des Dagegenseins geben. In einer Welt hingegen, in der mehr Teilhabe und Mitbestimmung möglich ist, kann auf Basis fester Grundwerte und Grundprinzipien auch ein „New Deal“ entstehen. Selbstverständlich müssen sich zuallererst auch die verantwortlichen Politiker*innen selbst an diesen Grundwerten orientieren.


Gemeinsam einsam
Das erste Semester im Studium kann etwas Besonderes sein. Neue Freund*innen, neue Freiheit. Nun heißt es plötzlich: Pandemie statt Party. Wie junge Menschen den Verlust eines Lebensgefühls empfinden.
Ich seh, ich seh, was du nicht siehst
Eine an der Kepler Universität entwickelte Drohne soll künftig dabei helfen, vermisste Personen selbst im dichtesten Wald zu finden. Es ist ein Meilenstein bei der Suche nach vermissten oder verletzten Menschen.


Es gilt die Unterlassungsvermutung!
Fehler besitzen die Eigentümlichkeit, sich einzuschleichen. Fehler können sich verheerend, lebensbedrohlich, inspirierend, amüsant oder völlig anders auswirken. Ich erinnere mich, vor Jahren einen Text über ein Konzert mit Nikolaus Harnoncourt und seinem „Concentus Musicus“ geschrieben zu haben. Telefonisch gab ich vor Drucklegung noch in breitem Oberösterreichisch einen mir wichtig erscheinenden und vergessenen Halbsatz zu Mozarts „Vesper“ durch. Am Tag darauf las ich in der Zeitung von Mozarts Vespa. Was umso lustiger war, da ich in gleichem Text und anderem Zusammenhang schon einen roten Ferrari in Stellung gebracht hatte. Ich bin sicher, dass dem hochgeschätzten Musiker in seinem reichen Künstlerleben niemals ein größerer Fuhrpark an italienischen Fahrzeugen unterstellt worden ist. Bis heute amüsiert mich die Auswirkung meiner Mundfaulheit mehr, als dass mir die offenkundige Inkompetenz peinlich ist.
Deutlich sprechen und niemals den Auslaut unterschätzen waren die Lehrinhalte. Manchmal lernt man schneller, als einem lieb ist. Gelegenheit macht Erfahrung, die nur ernst genommen werden muss, um wirksam zu werden. Sich selber nicht immer zu ernst nehmen, aber ernst genug, hilft. Auch wenn diese Gabe bei dem einen oder anderen Mitmenschen den Glauben hervorruft, dass man nicht ernst zu nehmen sei. Gelacht wird nur über die Fehler anderer. Unterschätzt zu werden ist nicht das Schlechteste. Dadurch kann man sich oft unbehelligt seiner Sache widmen und nicht den Erwartungen anderer. Es lebe die Subversion!
Fehler passieren und können gemacht werden. Ob man dabei eine aktive oder passive Rolle einnimmt, ist weniger entscheidend als die Wirkung, die die Abweichung vom Richtigen bzw. dem, was für richtig gehalten wird, auslöst. Wer macht bzw. lässt schon gerne Fehler geschehen? Wer dann sagt, ich entschuldige mich, gibt sich unbewusst selbstherrlich und macht damit den nächsten Fehler, der meist aus Unwissen passiert. Sollte die Entschuldigung ernst gemeint sein, muss man darum bitten. Dies selbstreflexiv zu tun, zeugt vielleicht davon, dass man mit sich selbst im Reinen sein will, aber bezieht in Wirklichkeit niemanden ein. Da entschuldigt man sich ein Leben lang und wird erst nach Jahrzehnten aufgeklärt, dass dies andere für einen tun müssen. Ich bitte dafür um Entschuldigung, Verzeihung oder Pardon. Unwissen schützt nicht vor Fehlern!
„Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa – durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld“ habe ich in jungen Ministrantentagen gelernt. Mit der Schuld ist es so eine Sache. Schon kramt man in der Lade, um gute Gründe für seinen Fehler zu finden. Gute Gründe sind nicht unbedingt wahre Gründe! Der Reflex im Windschatten eines Fehlverhaltens befördert oft eine überbordende Kreativität im Finden guter Gründe, eine wahre Schöpfungswut im Erfinden von Rechtfertigungen. Sich ausreden, ohne dabei eine Ausrede finden zu wollen, ist eine weit verbreitete menschliche Kunstform. Die gesteigerte Sonderform ist, Behauptungen aufzustellen, die für sich stehen, aber jeder Grundlage entbehren. Wer sich behaupten will, behauptet einfach, was das Zeug hält, und erhebt es damit zur unhinterfragten Wahrheit. Die Behauptung erhebt sich über alles.
Anderen die Schuld zu geben ist allerdings ein Leichtes, den Fremden, den Impfstofflieferantinnen, denen, die Impfstoffreste wegschmeißen wollten, den Ghostwritern wissenschaftlicher Arbeiten oder denen mit mangelndem Erinnerungsvermögen, den Müttern, die ihre Kinder so derart unmenschlich behandeln, dass sie sich wünschen, dass sie in einem sicheren Land aufwachsen, den Nichtmaskenträger* innen, denen, die keinen Abstand halten und keine Nähe suchen, denen, die hysterisch sind, Bill Gates, Donald Trump und den Tirolern (hier gendere ich bewusst nicht!), den Nichtverschwörungspraktikern, den Achtlosen, denen, die das Wir verachten und das Ich über alles stellen … Alles, was recht ist, was für eine Litanei, dürfen Sie gerne denken. Mit Recht und Gerechtigkeit ist es so eine Sache! Und es richtig zu machen und anderen recht mitunter ein Spagat, der nicht machbar ist.
Nicht selten hört man vom gänzlichen Fehlen einer Fehlerkultur in unseren Breiten. Sind wir doch ehrlich, wo Menschen zugange sind, existieren und passieren unentwegt Fehler. Wir leben in einer Fehlerkultur, nur die Fehlerumgangs- bzw. die Fehlererkenntniskultur ist sehr marginal entwickelt. Die Abweichung ist schlichtweg notwendig, um lebendig zu sein, falsch- oder erst recht richtigzuliegen. Dabei rede ich noch gar nicht von kreativen Prozessen in Kunst oder Forschung. Fragen Sie bei Einstein, Curie oder Miles Davis nach, wohin sie ohne Fehler gelangt wären. Wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Fehler sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des Treibstoffgemischs für Fortschritt.
„Keinen Gedanken verschwende auf das Unabänderbare“, schrieb Bert Brecht. Er hat recht, nicht selten beschäftigen wir uns mit Dingen, die ohnehin nicht mehr zu ändern sind. Doch noch öfter kommen wir gar nicht auf die Idee, eine haben zu können, um etwas zu ändern, für etwas aufund einzustehen. Wir machen den Fehler, erst gar nichts zu machen, weil wir gar zuschauen, wegschauen, eh nichts machen können. Die Unterlassung ist eines der größten Felder, auf dem wir Menschen Fehler machen.
Dann tritt ein siebzehnjähriger Schulsprecher namens Theo Haas auf und nennt die Dinge unprätentiös und deutlich beim Namen. Es kann nicht sein, dass sich jemand hinter dem Recht versteckt und sagt: „Wir handeln doch nur, wie das Gesetz es vorschreibt.“ Er sagt uns mit klarer, unaufgeregter Stimme, dass er „Recht muss Recht bleiben“ nicht mehr hören könne: „Wenn das Recht nicht für die Menschen und Kinder ist, muss es geändert werden. Das ist unsere Pflicht, aufzustehen und zu sagen, das geht so nicht, alles andere ist ein Fehler.“
Ich denke an die in Linz geborene Doro Blancke und ihre Flüchtlingshilfe. „Egal, wo ich bin, ob in Österreich oder im Ausland, ist es mir wichtig, den Dialog im Sinne der Menschen auf der Flucht im Auge zu behalten und Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsbrüche aufzuzeigen. Ein großes Anliegen besteht auch darin, die bewusst geschürten Ängste vor dem ‚Fremden‘ zu dezimieren“, liest man auf ihrer Website: Dafür sind Dialog, Austausch und das Kennen der Fakten von großer Bedeutung. Was sie letztendlich immer wieder antreibt, ist die Liebe zum Menschen, ihr Glaube an die Gerechtigkeit und das „Getragensein im WIR“. Theo Haas und Doro Blancke nenne ich hier stellvertretend für viele Menschen, die aufstehen, die Dinge beim Namen nennen und nicht nur das Wort ergreifen. Ihre Courage ersetzt nicht unsere eigene, aber ihr Mut erinnert uns daran und ermutigt uns im besten Fall, nicht den menschlichen Kardinalfehler des Unterlassens zu begehen.
Die Frage ist, welche Fehler darf man sich erlauben und welche erlauben wir uns einfach. Ganz unbehelligt. Es gilt die Unterlassungsvermutung!


Das Roboter-Rezept
Je näher uns Roboter kommen, umso weicher und angenehmer müssen ihre Oberflächen werden. An der JKU wurde deswegen ein besonderes Material
entwickelt: ein Biogel, das ohne fossile Kunststoffe auskommt. Und, wenn man es nicht mehr braucht, sogar biologisch abbaubar ist. Die Zutaten dafür
könnten aus einer Küche kommen.
Bitte ein Qubit
Quantencomputer werden die Welt revolutionieren. Physiker*innen tüfteln an der Maschine, Anwender*innen knobeln, was sie berechnen wollen – und der JKU Informatiker Robert Wille arbeitet daran, beide Welten zu vereinen.


Nicht auf Zukunft verzichten
In einer Universität und wohl im Besonderen in einer Kunstuniversität werden individuelle Interessen, Talente und Vorhaben hochgehalten, gepflegt, befördert und weiterentwickelt. Studentinnen und Studenten mögen ihren Weg finden, neue Ziele ausmachen, Methoden kennenlernen und durch eigenes Zutun schärfen, all das, um Lebensumständen nicht nur zu begegnen, sondern neue Impulse zu setzen und es gerade mit ungeplanten Herausforderungen aufzunehmen. Es braucht Selbstvertrauen – auch Leidenschaft schadet nicht – und den Hunger, sich immer wieder neuen und nächsten Fragen zu stellen, wie sich überraschenden Veränderungen auszusetzen, um auch Krisenzeiten nicht bloß zu ertragen, zu managen und auszusitzen. Universitäten tragen dazu bei, den Überblick zu bewahren, nicht nur damit etwas und irgendwas weitergeht, sondern auch um gegebenenfalls innezuhalten, zurückzutreten und nächste Schritte sorgfältig zu überlegen – ohne gefallen zu müssen. Universitäten bieten dafür nötige Denkräume für eine zukunftsfähige und in einer zukunftsfähigen Gesellschaft, damit sich individuelle Zugänge, frisches und unkonventionelles Denken formen können, immer auch als Grundvoraussetzungen für einen größeren Zusammenhalt. Erst die eigene Selbstsicherheit genauso wie begründeter Selbstzweifel erlauben und motivieren einen unvoreingenommenen Austausch über Fachgrenzen hin weg, hin zu anderen Disziplinen, hinaus in die Praxis, ohne Scheu vor dem Reality Check.
Gemeinschaftliche Auseinandersetzung und individuelles Selbstbewusstsein verbinden sich so zu wesentlichen Grundlagen für ein gewissenhaftes Handeln, für den Mut und die Bereitschaft, Verantwortung wahrzunehmen. Man weiß aus der Sozialforschung, dass prekäre und existenzbedrohende Lebensumstände nicht zu Zusammenhalt beitragen, vielmehr in Resignation und Aussichtslosigkeit enden. Uns fortgeschritten Erwachsenen erscheint unsere unmittelbare Gegenwart nicht selten geschichtsloser denn je, doch zeigt sich eines deutlich: Junge und noch jüngere Generationen lassen sich ihr Recht auf Zukunft nicht nehmen. Sie wenden und werten zutiefst nötige Solidarität als gesellschaftsbildende Kategorie neu, bedarf es doch zu deren dringlicher Einlösung aktueller und ungewöhnlicher Lösungsansätze auf Augenhöhe.
Nur wenn es gelingt, überzeugende Aussichten auf machbare Veränderungen zu stärken, zu entwerfen und daran festzuhalten, lässt sich Zukunft fassen und für viele erst begreifen. In diesem Sinne bilden Universitäten keine Enklaven, sondern eröffnen sichere Freiräume, in denen junge und scharfe Geister nicht auf Zukunft verzichten. Und es gilt jetzt und weiterhin, diese Privilegien zu teilen.
Der richtige Ton
Ein Kind mit Hörbeeinträchtigung stellt für viele Eltern die Welt erst mal auf den Kopf. Eine neue Studie will die Entwicklung der Kinder umfassend begleiten und so herausfinden, was das Beste für sie ist.


Mission possible
Das neue EU-Rekordbudget soll die Volkswirtschaften der Union nach der Pandemie nicht nur wiederbeleben, sondern auch für künftige Missionen startklar machen. Aber wie können die Universitäten davon profitieren?
Ein Ende mit Schrecken
Auch wenn die hohe Staatsverschuldung derzeit kein Problem scheint, sie wird mit Garantie eines. Noch ist Konsolidierung für die Politik kein Thema, doch Wirtschaftsforscher*innen warnen bereits.

 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite