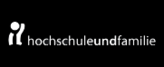Alle Gesichter zum Download
Sie möchten mal aus Ihrer Haut heraus und sich in andere hineinversetzen? Verstehen lernen, wie sich andere fühlen? Oder Sie haben etwas zu sagen, sind sich aber nicht sicher, ob Sie das auch dürfen? Sie wollen mitreden, glauben aber, nicht der richtigen Gruppe anzugehören, und haben Angst, deswegen ein Sprechverbot zu bekommen? Dann kann Ihnen geholfen werden.
Wir haben insgesamt fünf verschiedene Covervarianten unserer Print-Ausgabe gestaltet, mit fünf unterschiedlichen Masken darauf. Hier haben wir alle Masken zum Download gesammelt.
Schneiden Sie sich eine der Masken aus und reden Sie mit!
Entpört euch!
Die Debatte darüber, was legitime Kritik und was freiheitsfeindliche Zensur ist, wird härter und aggressiver. Wie steht es wirklich um die Meinungsfreiheit? Ein Essay von JOCHEN BITTNER.
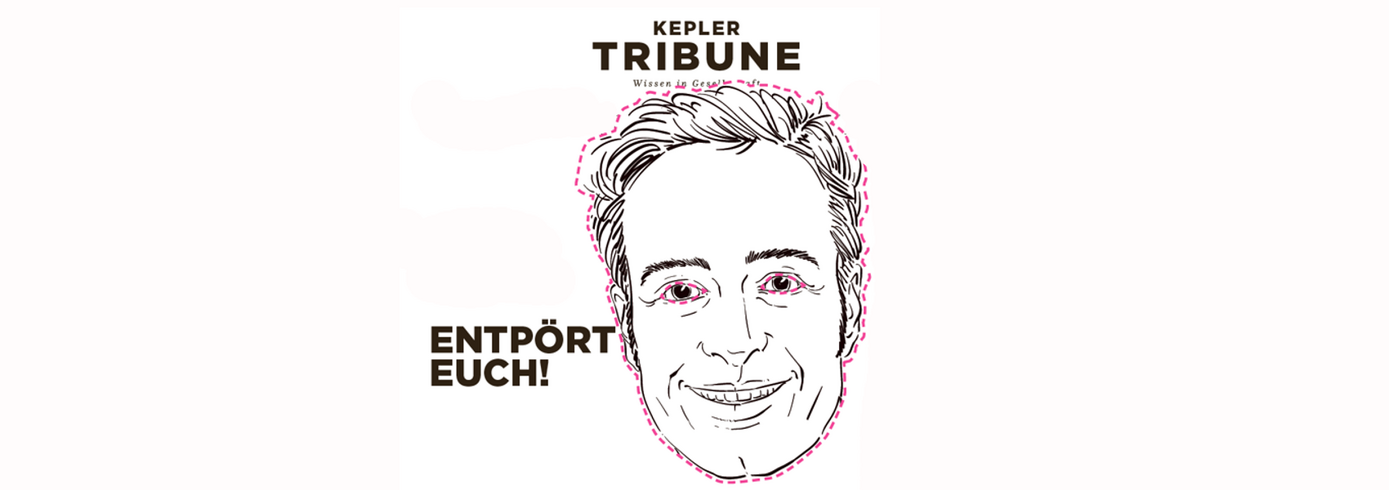
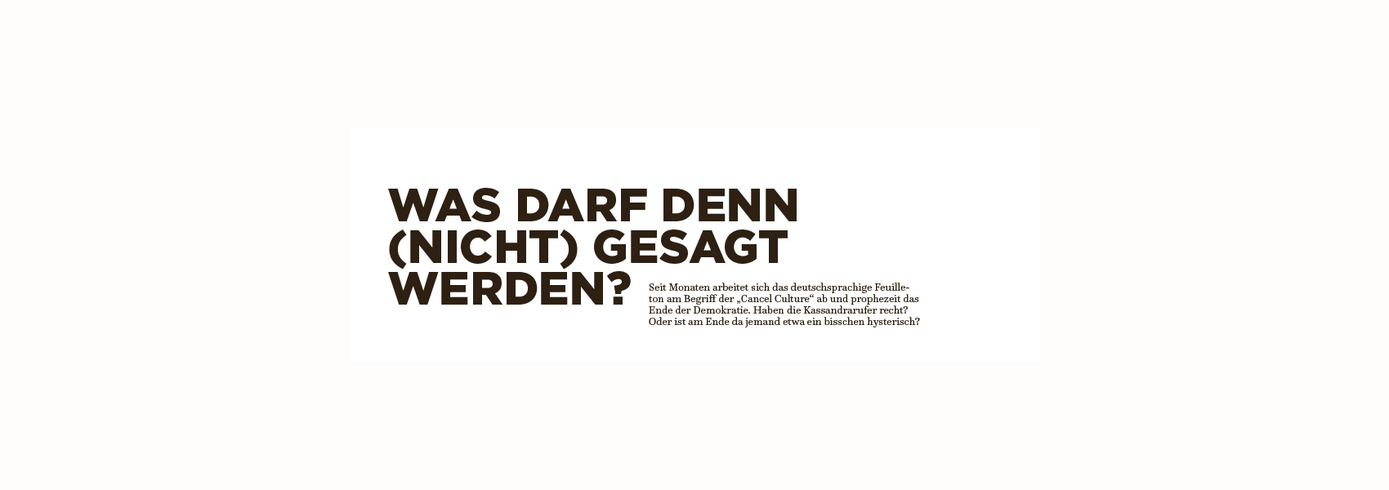
Was darf denn (nicht) gesagt werden?
Seit Monaten arbeitet sich das deutschsprachige Feuilleton am Begriff der „Cancel Culture“ ab und prophezeit das Ende der Demokratie. Haben die Kassandrarufer recht? Oder ist am Ende da jemand etwa ein bisschen hysterisch?
Cancel Couture
Es gibt eine Obsession mit der „linken Identitätspolitik“, so schreibt es der Autor Robert Misik in einem Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung, um im weiteren Verlauf die Gegensätzlichkeit zweier Standpunkte als bloß vermeintlich zu enttarnen. Trotzdem seien behauptete Gegenpositionen auch hier vorangestellt: Auf der einen Seite fänden sich angeblich jene, die die soziale Frage ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen. Und dann gäbe es die, deren Gedanken zur gerechten Gesellschaft sich um einen angeborenen Identitätsbestandteil zentrieren und ihn gewissermaßen losgelöst betrachten, was also heißt, dass sie zwar Rassismus und Sexismus strukturell erkennen, nicht aber Klassismus. So weit, so einfach. Wer bloß binär denken kann, ist klar im Vorteil, weil man dann nicht mit den Zwischentönen durcheinanderkommt und die eigene Meinung als Position unumstößlich in der Landschaft steht.
Cancel Culture von links, bedrohte Kunstfreiheit, Selbstviktimisierung als Waffe: Die Schlagwörter sind bekannt. Aktuell entzünden sie sich innerhalb des Theaterbetriebs an einer Debatte, ausgelöst durch Rassismusvorwürfe gegenüber dem Düsseldorfer Schauspielhaus: So schilderte der Schauspieler Ron Iyamu Ende März rassistische Äußerungen und Übergriffe in Probensituationen. Dagegen hielt der Dramaturg Bernd Stegemann in einem Text in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er die Besonderheit der Probensituation beschreibt: Stegemann sieht die Probe als Ort der Entgrenzung, an dem die Regeln des Alltags eben nicht gelten, ein Möglichkeitsraum gewissermaßen, in dem Kunst und Künstler* innen erst mal frei sind, ohne dass Einzelne diese Freiheit für ihre Zwecke missbrauchen.
Die Frage nach dem Möglichkeitsraum der Probe ist unbedingt zu stellen. Nicht als Argument gegen Safe Spaces, das die Grenzen des Raumes ziemlich eng zieht und so mehr verunmöglicht, als es eröffnet. Sondern als ein Eintreten für das offene Ausverhandeln des Spielfelds als zukünftigen Common Ground, in dem die Realität durch die Körper der Beteiligten als Realitäten stets präsent, aber nicht festgeschrieben ist.
Denn ein Ausblenden dieser Realitäten wäre wie deren Reduktion ins Singular, wäre Überschreibung und gleichzeitige Zurichtung der Körper, Zugriff und Ausschluss, ein Abziehen der – wie Mithu Sanyal in einer Replik auf Stegemann schreibt – „sozialen Haut, (…) die es uns erlaubt, gleichzeitig Teil der Gesellschaft und wir selbst zu sein – unverletzbar, weil eine Verletzung von uns gleichzeitig eine Verletzung der Gemeinschaft wäre“.
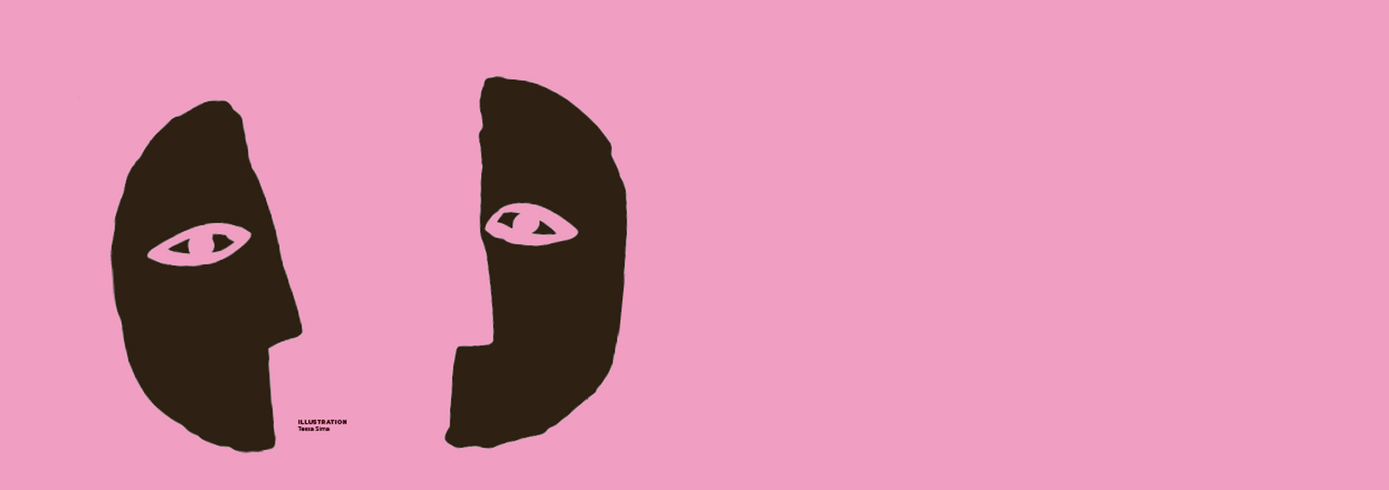
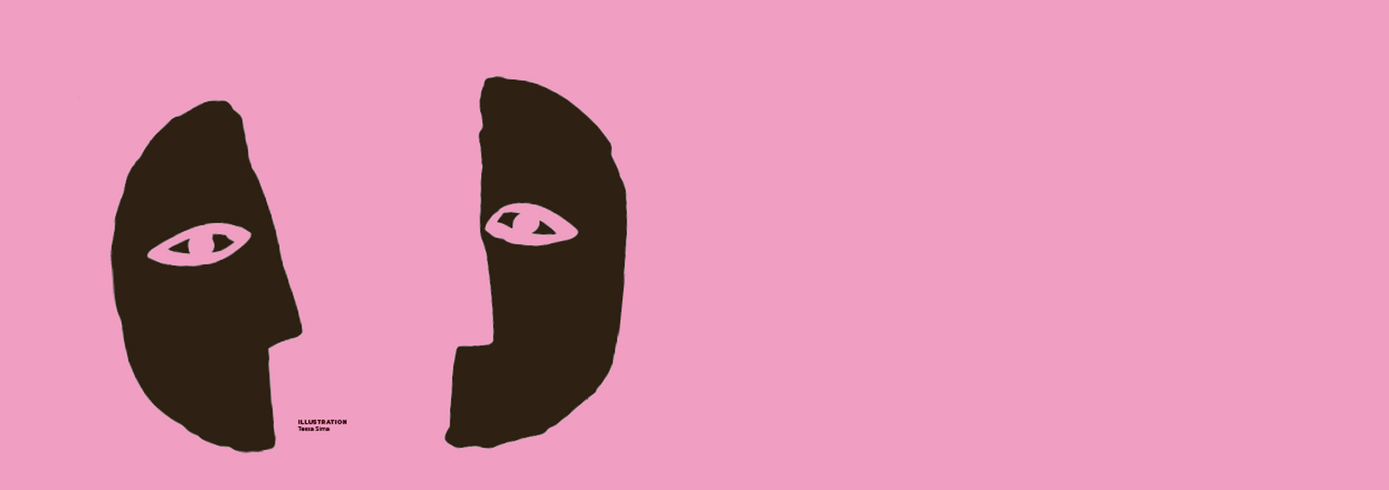
Cancel Culture zwischen verkürzten Argumenten und legitimem Aktivismus?
Die mannigfaltigen Krisenerscheinungen des 21. Jahrhunderts (z.B. Finanz-, Migrations- oder Corona-Krise) verstärkten soziale Ungleichheiten. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Ethnizität oder Religion ist alltäglich. Daher ist der Bedeutungsgewinn von Social-Media-Aktivismus wenig verwunderlich: Marginalisierte Gruppen nutzen Plattformen wie Twitter oder Facebook, um soziale Ungerechtigkeiten breit zu kommunizieren und Verantwortliche unmittelbar zur Rechenschaft zu ziehen.
Dieses Vorgehen wird als canceln bezeichnet und hat u.a. erfolgreich Eliten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, aber auch Wissenschaft unter Druck gesetzt (z.B. #metoo oder #blacklivesmatter). Potenziell führt dieses Vorgehen also zur Ermächtigung von Opfern oder Benachteiligten, unterbindet die Reproduktion von Ungerechtigkeiten und reinigt den öffentlichen Diskurs von problematischen Akteur*innen oder Inhalten.
Warum also hat die Cancel Culture eine negative Konnotation? Sind deliberative Demokratien doch auf aktive Bürger*innen angewiesen, die am öffentlichen Diskurs teilhaben, gesellschaftliche Probleme identifizieren und mittels faktischer Argumente schädliche Diskurselemente entfernen (Habermas).
Der für diesen Diskurs notwendige Möglichkeitsraum hat sich aber sukzessive verengt: Einerseits forcierten politisch meist rechts verortete Kräfte mittels populistischer Rhetorik eine absolute „Wir gegen Sie“-Logik, die emotionalisiert und das faktische Argument verdrängt. Andererseits etablierte sich, insbesondere in politisch links orientierten progressiven Kreisen, eine dogmatische Kultur des politisch Korrekten, deren moralische Fundierung auch bei komplexen Sachfragen unhinterfragbar wirkt. Was einzelne Akteur*innen aber als korrekt verstehen, bleibt im Social Media gestützten Meinungsaustausch meist unspezifisch und bietet Konfliktpotenzial innerhalb progressiver Gruppen.
Und hier zeigt sich das Problem der Cancel Culture: Ohne diskursives Ausverhandeln von Positionen droht die Gefahr, dass eine Cancelation auf das oft unterstellte „Lynchen“ von Individuen reduziert wird, aber die dahinterliegenden legitimen Anliegen von marginalisierten Personengruppen von dem Spektakel inhaltlich verengter Social-Media-Konflikte verdrängt werden. Was schlussendlich auch verhindert, dass die eingangs angesprochenen sozialen Ungerechtigkeiten eine Aufarbeitung erfahren. Und genau dieser Diskurs wäre für Gesellschaften zentral, da er das Potenzial für soziale Kohäsion schaffen könnte.
Mathematik verkehrt herum
Weit draußen im Weltall stoßen wir auf einige der größten Rätsel der Wissenschaft. Die Mathematik, mit der man sie entschlüsseln kann, hängt eng mit konkreten irdischen Anwendungsgebieten zusammen, etwa mit der Computertomographie. An der Kepler Universität forscht man an „inversen Problemen“, die oft unerwartete Erkenntnisse bringen – über das Innere unseres eigenen Körpers genauso wie über die Geheimnisse des Kosmos.


Stimmen aus dem Jenseits
Die Möglichkeiten einer digitalen Welt könnten unsere Trauerarbeit nachhaltig verändern. Was wäre, wenn wir geliebte verstorbene Menschen in einer virtuellen Welt wiedertreffen könnten? Oder wenn gar wir selbst unseren Tod selbstbestimmt überdauern könnten? Der Traum vom ewigen digitalen Leben birgt jedoch nicht nur Hoffnung, sondern auch Gefahr.
„Im Talar sitzt eine Richterin, keine Maschine“
Der neue Schwerpunkt „Procedural Justice“ an der JKU Linz richtet das Augenmerk auf die Wege, die zur Umsetzung von Recht führen. Ein Forschungsgegenstand sind die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Gerichtsbarkeit.
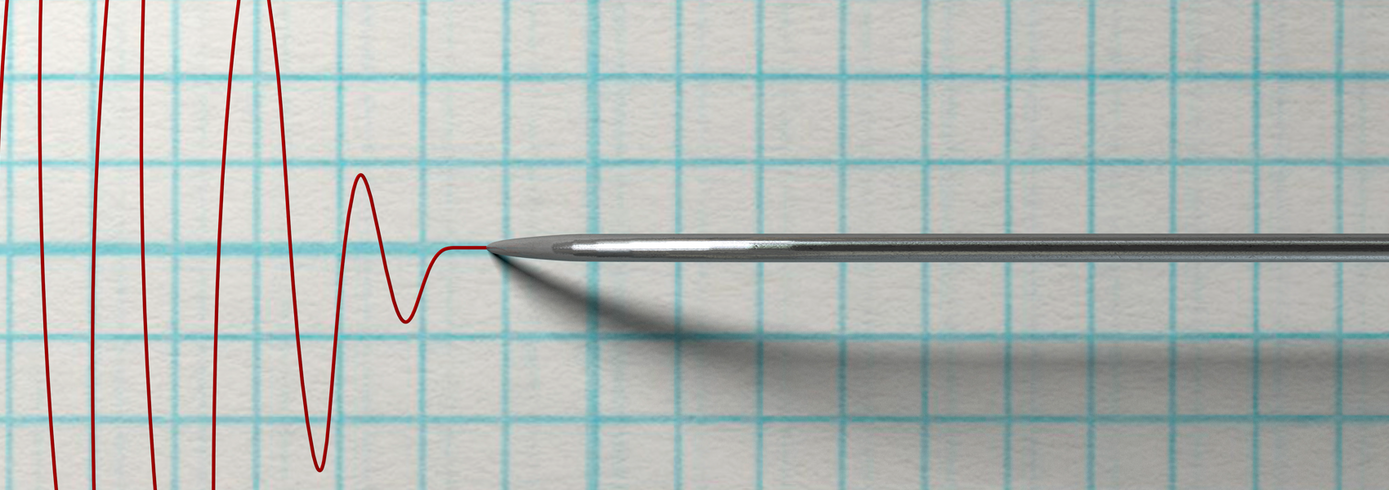

Durchblick für Spot
Der berühmte Roboterhund von Boston Dynamics kommt an die JKU. Für ein Projekt des Ars Electronica Festivals 2021 soll er mit einem zusätzlichen Sinn ausgestattet werden.
Die Fairness der Bauanleitung
Algorithmen bestimmen das Leben in immer größerem Ausmaß, im Guten wie im Schlechten. Sie werden oft dafür kritisiert, Diskriminierungen weiterzutragen. Das Problem liegt aber oft tiefer.


Die Kraft der Begeisterung
Schuhe gibt es in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Damit für jeden etwas dabei ist. Warum soll das bei Wissen und Wissenschaft anders sein? Mit ihrem bunten Angebot für Kinder, unter anderem dem „Zirkus des Wissens“ und der bald erscheinenden dritten Ausgabe des „Tribünchens“, hat sich die JKU Linz genau diesem Gedanken verschrieben: Wissenschaft spannend zu machen. Weil jedes Kind das Recht auf Wissen und Erkenntnis hat.
Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Manchmal, in schlechten Nächten, träume ich vom Krieg. Ich träume davon, was meine Eltern verloren haben: ihr Geschäft, ihre Arbeit. Ich träume von meiner Stadt, dem Lachen auf den Spielplätzen meiner Kindheit. Dem Bäcker, dem Geruch in den Straßen, dem Basar und den Gebeten in der Moschee. Von einer Stadt, die es nicht mehr gibt, von Erinnerungen an Ecken, die Panzern und Granaten gewichen sind. Vom Feuer, das den Basar vernichtet hat.
Als Kinder und Jugendliche kannten wir Flüchtlinge. Es waren Menschen aus dem Irak, die vor dem Krieg nach Syrien geflohen sind. Da denkt man nicht, wie schnell man selbst in so einer Situation sein kann. Natürlich haben wir in Aleppo im Frühling 2011 ferngesehen. Viele waren auf der Straße. Nie hätten wir gedacht, dass nur wenige Monate später aus den Protesten ein Bürgerkrieg wird.
Die ersten Angriffe auf Aleppo und auf unsere Universität waren schockierend. Wir konnten nicht glauben, dass Syrer auf Syrer schießen. Genauso wenig, wie schnell sich das Leben ändert. Aus den Träumen meiner Generation von einem guten, schönen, freien Leben wurde das Gefühl, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Dass Überleben der letzte Traum ist, der einem noch bleibt. Ein Traum, der aber wie ein nicht endender Albtraum aussieht. Menschen verlieren Geld, Arbeit und Hoffnung. Das Leben dominieren schlaflose Nächte, gefolgt von hoffnungslosen Tagen, gefüllt mit schrecklichen Erlebnissen.
2015 habe ich mich entschieden, Aleppo und Syrien zu verlassen. Ich wollte mein Herz, meinen Kopf und meine Gedanken nicht dem Krieg geben. Ich wollte nehmen, was mir der Krieg gelassen hat, und es in die Welt tragen. Ich wollte wieder träumen. Groß träumen. Träumen von morgen und nicht von gestern.
2017 habe ich an der JKU mein Masterstudium Molecular Biology begonnen und 2020 abgeschlossen. Das Borealis-MORE-Stipendium der JKU half mir finanziell, aber auch mental. Jetzt arbeite ich als Doktorandin am Institut für Biophysik.
Ich trage ein Kopftuch. Es steht für meine Religion und meine Heimat und für eine Generation junger Syrerinnen und Syrer. Wir haben viele verloren. Ich träume von einem Syrien, in dem das entscheidet, was in unseren Köpfen entsteht. Einem Syrien der Wissenschaft, der Offenheit, des Respekts und des Glaubens an unsere gemeinsame Zukunft. Es ist ein großer Traum – aber es ist ein Traum für morgen. Ich träume davon, dass wir es schaffen.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal spricht Hadil Najjar, die ihr JKU Studium mit Unterstützung eines Borealis-MORE-Stipendiums absolviert hat. Es richtet sich an Studierende mit Fluchthintergrund.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: Somnium - Der Traum von Wissenschaft mit Richard Küng


Sag, wie hast du’s mit der Identität?
Es ist so einfach wie trendy, Identitätspolitik für das Versagen linker Politik verantwortlich und sich im gleichen Atemzug darüber lustig zu machen. Statt mit Macht- und Verteilungsfragen beschäftige man sich nun mit Gendersternchen und Unisex-Toiletten. Prominente Kritiker*innen wie Francis Fukuyama, Slavoj Žižek und zuletzt Sahra Wagenknecht gehen sogar so weit, der Identitätspolitik das Erstarken rechtspopulistischer Strömungen anzukreiden: Statt sich um ökonomisch Ausgebeutete zu sorgen, konzentriere man sich auf die Partikularinteressen immer kleinerer sozialer Gruppen und verliere das große Ganze aus den Augen. Statt universalistisch und vereinigend zu agieren, würde man so erst recht zu gesellschaftlicher Spaltung beitragen.
Dieser Vorwurf stimmt dann, wenn Identität als fundamental und essentialistisch verstanden wird und in weiterer Folge die daraus resultierende Gruppe als homogen. Soziale Identitäten sind aber eben nicht unbeweglich und exklusiv und entspringen auch nicht einer homogenen „Essenz“ unseres Wesens, das schon immer war und auch in Zukunft immer so sein wird. Vielmehr gilt es, Identitäten als kontextabhängig, intersektional und – zu einem hohen Grad, wenn auch nicht vollständig – wandelbar wahrzunehmen. Die eigene Positionierung als Mitglied einer Religionsgemeinschaft bedeutet eben nicht, dass man nicht auch eine geschlechtliche, nationale, sexuelle oder ethnische Identität hat, und dass diese unterschiedlichen Identitäten nicht ab und an auch in Konflikt miteinander stehen können. Verschiedene Kontexte aktivieren bestimmte Gruppenzugehörigkeiten, während sie andere in den Hintergrund treten lassen. Politische Forderungen aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe abzuleiten, bedeutet auch nicht, dass aus der Identität als Frau oder als Homosexuelle zwingend bestimmte Merkmale, Haltungen oder Einstellungen folgen müssen. Wird diese Dynamik der sozialen Positionierung aufgrund der Realität multipler Zugehörigkeiten ausgeblendet und Identität als statisch, binär und gegeben angesehen, so greifen darauf aufbauende politische Forderungen in der Tat zu kurz.
Denn genauso wie Identität und Zugehörigkeit ist auch Solidarität nicht starr und kontinuierlich. Eine vielfältige und sich immer rascher verändernde Gesellschaft bringt auch stetig wechselnde Solidaritäten hervor. Beim Ausbruch der Corona-Krise erlebte Österreich eine neue Solidarität mit älteren Menschen – der etwas unglücklich titulierten Risikogruppe. Das war in seiner konkreten Ausformung doch erstaunlich, bestimmten doch bis kurz vor Ausbruch der Pandemie hitzige Debatten über Generationenkonflikt, desillusionierte „Millennials“ und privilegierte „Boomer“ den medialen Diskurs. Dieses abrupt formierte Bewusstsein für die Notwendigkeit der Solidarisierung aus einer fast konträren Situation heraus versinnbildlicht, wie unstet und wechselhaft Solidaritäten sein können.
Der Soziologe Jörg Flecker und seine Kolleg*innen identifizieren in Umkämpfte Solidaritäten gar sieben verschiedene Formen von Solidarität, von universeller Hilfeleistung bis hin zu moralischer Verpflichtung. Ihnen allen gemein ist Nähe als Grundvoraussetzung: Um solidarisch handeln zu können, bedarf es einer vertiefenden Auseinandersetzung mit jenen, denen man seine Solidarität angedeihen lässt. Deshalb stehen hinter verschiedenen Ausformungen von Solidarität unterschiedliche Kategorien des „Wir“: Wird Zugehörigkeit national definiert, also anhand derselben Staatsbürgerschaft, oder kulturell, also anhand derselben Abstammung? Sind es wir, die Leistungsträger*innen, oder wir, die aus demselben sozialen Milieu stammen? Wir, die Frauen, oder wir, die Arbeiter*innen? Je nach Situation sind diese Kategorien fließend, sie verändern sich im Laufe der persönlichen Biografie genauso wie nach sozialem Kontext oder aufgrund großer globaler Umwälzungen wie eben einer Pandemie.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist Identitätspolitik alles andere als die banale Nabelschau einer fehlgeleiteten linken Politik. Wie wir unsere Zugehörigkeiten und daraus folgend unsere (wechselnden) Solidaritäten definieren, ist Grundlage für politisches Handeln und politische Forderungen. Mit welchem „Wir“ man sich identifiziert, zu welchem man zugehörig sein will und kann, bedingt auch die inhaltliche Positionierung. Nicht erst seit dem Jahr 2021 ist Gruppenzugehörigkeit ein bestimmendes soziales Element. Das „Wir“, in das man ein- oder aus dem man ausgeschlossen wird, entscheidet über berufliches Vorankommen, Bildungschancen, Gesundheit und Lebenserwartung, Wohnverhältnisse und Überlebenschancen in Zeiten der Krise. Identität und materielles Interesse gehen Hand in Hand.
„Identität war immer schon“, konstatiert deshalb die Soziologin Paula- Irene Villa Braslavsky und meint damit, dass seit der Moderne jede Form der politischen Auseinandersetzung ein Eintreten für bestimmte soziale Gruppen war. Die vermeintliche Neutralität, die vor der neumodischen Identitätspolitik geherrscht haben soll, gab es nie. Denn die wesentliche Frage, die hinter der Gestaltung politischer Maßnahmen steht, ist, wer als die Norm für ebendiese gilt, und wer als seine Abweichung. Lange Zeit galt der Mann als das Allgemeingültige, während die Frau als das „andere Geschlecht“ und somit als außerhalb des Allgemeinen definiert war, wie es Simone de Beauvoir in ihrem feministischen Fundamentalwerk ausdrückte. Genau darin zeigt sich auch die Ironie der Kritik an Identitätspolitik: Tatsächlich geht es Strömungen wie dem Feminismus oder Antirassismus weniger um selektive Partikularinteressen nach immer kleineren Zugehörigkeiten, sondern darum, dass Grundrechte wie Schutz vor Polizeigewalt, Recht auf Ehe und Familie oder Gleichbehandlung vor dem Gesetz allgemeine Gültigkeit erlangen, also tatsächlich für alle und nicht für eine bestimmte Identität (die bisherige, eng gefasste Norm) gelten. Aus diesem Grund sei Identitätspolitik auch besser als „Politik für Minderheiten“ zu bezeichnen, wie der Politologe Jan-Werner Müller argumentiert. Die Bewegungen, die nun verkürzt unter dem despektierlichen Banner der „Identitätspolitik“ zusammengefasst werden, eint also, dass sie für eine radikale Neudefinition des „Wir“ kämpfen – weil es eben klare materielle Vorteile mit sich bringt, Teil davon zu sein. Für das „Wir“ gelten Grundrechte, die für „die Anderen“ noch immer nicht selbstverständlich sind. Deshalb versuchen Black Lives Matter oder die Trans*Bewegung, individuelle Verwundbarkeit allgemein bewusstzumachen, daraus resultierende Verletzungen ernst zu nehmen und sie gleichzeitig zu minimieren, wie man es im Rückgriff auf Judith Shklars Liberalismus der Furcht formulieren könnte. Diese Verwundbarkeit durch Gewalt oder Ungleichbehandlung ist bedingt durch Ausschluss aus dem „Wir“, das über die rechtliche wie soziale Ordnung bestimmt.
Die mitunter schmerzhafte Debatte um Identitäten ist also deshalb so notwendig und unumgänglich, weil sie die radikale Forderung nach Überwindung von Ausgrenzung bedeutet. Identitäten bleiben bestimmend in einer Gesellschaft, in der Gruppenzugehörigkeit die eigene Verwundbarkeit oder eben Unversehrtheit – körperlich, ökonomisch und politisch – determiniert. Soziale Differenz soll weder überwunden und negiert noch betont und fetischisiert werden. Sie soll nur unerheblich für die Teilhabe am „Wir“ sein.
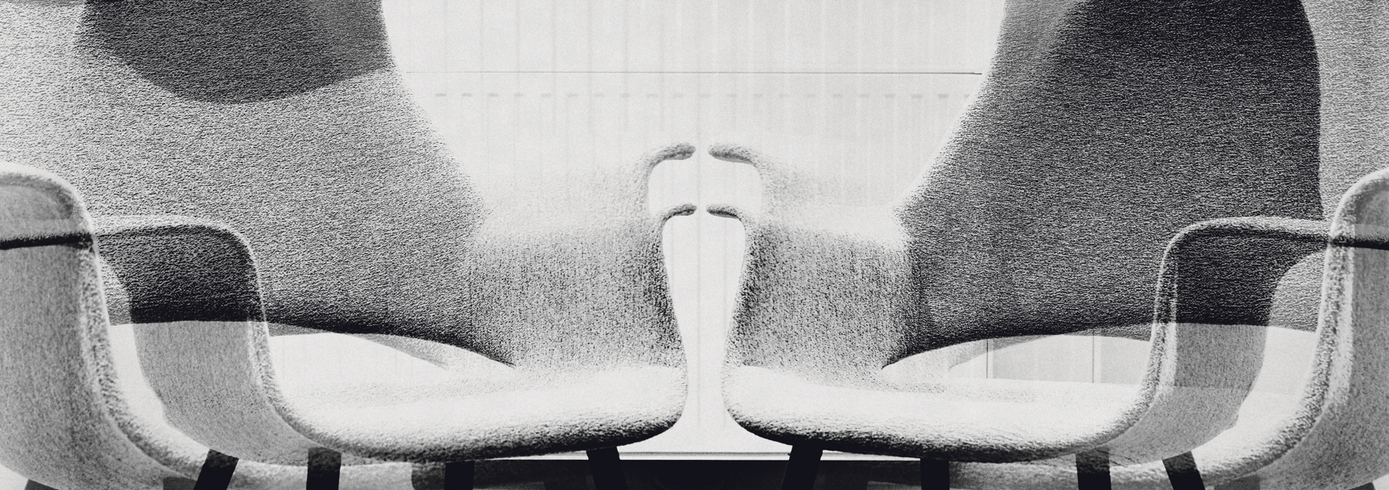
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite