
Exklusive Leerzeichen
Um sich einem Ding, einem Phänomen zu nähern, es möglichst treffend zu beschreiben, ist es oft hilfreich, zu definieren, was es – in diesem Fall das Leerzeichen – nicht ist: Im Unterschied zu Zeichen haben Leerzeichen ihre eigene Wirklichkeit im Griff. Sie sind leer. Leer im Sinne von „kenos“ (griech.), was den Unterschied zwischen Seiendem und Nicht-Seiendem ermöglicht. Leerzeichen werden gerne übergangen und bei etwaigen Calls und Ausschreibungen in Wissenschaft und Kunst inklusiv gesehen. „Abstract so und so viele Zeichen inklusive Leerzeichen.“ Kein Fisch im Vogelkäfig. Was zählt, sind Zeichen: „Bitte keine Leerzeichen in den Dateinamen.“ Das Leerzeichen enthält keine Information. – Ist dem so, enthält das Leerzeichen wirklich keine Information? Oder ist es vielmehr der Platz oder Platzhalter einer versagten Information?
Wenn ich nur aufhören könnt …
Norbert Trawöger denkt übers Aufhören nach und bemerkt, dass dieses mindestens zweier Anfänge bedarf – den, an dem alles beginnt, und den, an dem das Aufhören anfängt.


„Mitwelt“ statt „Umwelt“
Ein Denkanstoß zum „wording“ in der Klimakrise
Am Anfang steht Ansfelden.
Am Anfang steht Ansfelden, nicht Städte wie Bonn, Hamburg oder Wien. Die Welthauptstadt der Musik war Anziehungsort und oft Endpunkt für Klangschaffende. Der junge Ludwig van Beethoven kam aus Bonn, um bei Wolfgang Amadé Mozart in Wien in die Lehre zu gehen. Der hatte gerade keine Zeit für ihn. Als Beethoven wiederkehrte und blieb, war Mozart schon tot. So nahm er bei Joseph Haydn Unterricht. 1872 übersiedelte der in der Hansestadt Hamburg geborene Johannes Brahms für sein letztes Lebensvierteljahrhundert nach Wien, wo er 1897 knapp ein halbes Jahr nach Anton Bruckner starb. Gestorben sind sie alle in Wien, die großen Männer der vergangenen Musikgeschichte. Das hat sich geändert, wie Komponistinnen viel zu langsam, aber sicher mehr Rolle spielen, wenn auch die Musik in der Gesellschaft eine ganz andere.
Aber zurück zum Anfang und Ansfelden. Am 4..September.1824 wird dort Anton Bruckner als erstes von elf Kindern – von denen fünf überleben. – geboren. Als Sohn von Theresia (1801–1860) und Anton Bruckner (1791–1837), der als Schullehrer und Kirchenmusiker in Ansfelden tätig war. Anton Bruckner kommt vom Land, das er und das ihn nie verließ, selbst als er seine letzten Lebensjahrzehnte in der Donaumetropole Wien verbracht hat. Wenige Komponisten von Weltrang kommen aus ländlichem Umfeld. Hier ereignete sich Bruckner zwischen Kyrie rufen und Landlerschritten, Tanzboden und Kirchtürmen, Hügeln und Wäldern. Wer hört, der kann es hören. Eigen war er ganz gewiss. Bruckner gehört zu uns, gehört uns aber nicht. Seine Musik gehört der ganzen Welt, wird in der ganzen Welt gespielt und gehört. Bruckner ist mehr als Oberösterreich, von wo er aufbrach. Er ist Welt, aber er kommt von diesem Land, diesem Ort: „Locus iste“ – was nichts anderes heißt als „Dieser Ort“ – sind die Anfangsworte der lateinischen Motette für vierstimmigen gemischten Chor, die zu Bruckners Welthits zählt.
Die Sorge von Bruckners Vater für die Kirchenmusik des Orts galt früh dem musikalischen Sohn. Vielleicht, weil es sich so gehört hat. Sein Feuer wurde angezündet, die Blasbälge der Ansfeldner Orgel sorgten für reichliche Sauerstoffzufuhr. Die Orgel ist der Ort, an dem Bruckner sein Handwerk anzulegen beginnt. Über dem Hügel lag Sankt Florian, es liegt dort immer noch, wie der Entfachte selbst unter seiner Orgel. Das Stift war für den blutjungen Bruckner, wo er nach dem frühen Tod seines Vaters Sängerknabe wird, eine frühe Ahnung von einer ganz anderen Dimension. (Eine Vorahnung hat er wohl schon in Ansfelden erfahren. Der stattliche Pfarrhof wurde –.wie das Stift – vom Barockbaumeister Carlo Antonio Carlone erbaut, in dem die Pröbste von St. Florian ihre Sommerfrische verbrachten.) Die Tradition, der Kirchenraum expandiert sein Vorstellungsvermögen. Bis heute staunt man über die Ausmaße des Stifts. Eine Großmächtigkeit, die durchaus Einschüchterndes an sich hat und im besten Fall Demut auszulösen vermag. In den Weiten und Engen des sakralen Gehäuses wächst Bruckner heran. Und nicht nur das, dieser steht auf dem Land, auf der grünen Wiese, nahe der größeren Stadt Linz, die damals noch kleiner und viel ferner war als heute.
Bruckner geht nach Linz, wird Domorganist. Im Linzer Theater hört er Wagners „Tannhäuser“. Dieses Ereignis wird ihm zum Erweckungserlebnis, „gibt“ ihm die Erlaubnis zum Eigenen. Der Ausbruch ist im Gange. Er sorgt selbst unablässig dafür. Hätte er nicht ein ewiger und unvergessener Kirchenmusiker bleiben können? Ein weltberühmter Orgelimprovisator, der in Nancy, Paris und London im Klangrausch Tausende Menschen erobert. Mit über vierzig Jahren bricht er endgültig aus, um lebenslang wieder und wieder auszubrechen, auch aus dem Kirchenraum. Er findet sich und seine Sprache im weltlichen Formgelände der Sinfonie. Sinfonieskulpturen von exzessiven formalen und tonalen Dimensionen, die wie fremdartige, unverständliche Meteoriten einschlagen. Sie sind angebunden an die Tradition und blicken weit über die Horizonte zum Avantgardistischen hin. Sie erzählen keine Ich-Geschichten, sondern schlagen einen transpersonalen Raum auf. Erst mit der „Siebten“ kann er im Alter von sechzig Jahren einen ersten großen Erfolg in Leipzig und München feiern. Alles hat seine Grenzen. Nur nicht Bruckner. „Er ist jenseits“, drückt es sein Wiener Gegenspieler Johannes Brahms aus. „Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“, ist ein Ausspruch, der Bruckner in die Schuhe geschoben wird. Wenngleich dessen Urheberschaft eine Unterstellung zu sein scheint, gilt dieser schöne Satz für Bruckners Schaffen in besonderem Maße. Obendrein wird dieser Satz ebenso Aristoteles angedichtet. Für diesen Fall ist er schon gut 2.100 J a h r e vor Bruckners Geburt gefallen.
Der Zweifel feiert in unseren Tagen nicht unbedingt Hochfeste. Oft und lautstark etwas zu verkünden, reicht oft als Wahrheit aus. Etwas zu hinterfragen, heißt nicht gleich, misstrauisch durch die Welt zu gehen. So sind viele Klischees und Wahrheiten rund um Bruckner in Zweifel zu ziehen. Er war gewiss ein frommer Mann, aber kein Musikant Gottes. Er ist in seiner Ambivalenz und scheinbaren Widersprüchlichkeit schwer zu fassen.
Wer sich mit dem Menschen Bruckner befasst, muss sich auseinandersetzen, stößt auf Krisen, Zweifel und Beharrlichkeit. Dies gilt auch für die Aufführungsgeschichte seines Werks, in die sich zu oft epische Breiten, Pathos und viel Weihrauch imprägniert haben, ohne am Papier, in der Partitur wirklich manifest zu sein. Der Partitur auf der Spur zu sein, heißt in dem Sinn nichts anderes, als Fragen zu stellen. Die Antworten darauf werden nicht weniger vielfältig ausfallen, denn letztlich entscheidet die Interpretin, der Interpret, was zumindest für den Moment des Erklingens wahr ist. Bruckner beherrschte sein kompositorisches Handwerk wie wenige im 19. Jahrhundert und begriff sich im Fluss der Musikgeschichte. Seine singuläre Musik zeugt vom Blick eines Avantgarde- Schaffenden, der die Zukunft voraushört. Eine andere künstlerische Perspektive einnimmt als die meisten seiner Zeitgenossen. Was Unverständnis heraufbeschwören musste.
Faszinierend an seiner Musik ist, dass sie einem nicht entgegenkommt. Es ist Musik, die offen ist, in die und der man sich bewegen, „reingehen“ kann, durch alle Poren der Klänge eindringen kann. Es ist keine Anbiederungsmusik. Was für eine Chance unserer Tage, den Flugmodus unserer Mobiltelefone in einen Hörmodus zu transformieren und in den „Space“ der Klangwelt von Anton Bruckner ein-, vielleicht auch abzutauchen. Es ist eine Erfahrung, die mehr als nur drei Minuten Dauer garantiert, man kann sich darin gesichert für mindestens eine Stunde einfinden. Die Sinfonien dauern bis zu 90 Minuten, was für eine geschenkte Zeit! „Wo ihr unübersteigliche Schranken gesetzt sind, da beginnt das Reich der Kunst, welches das auszudrücken vermag, was allem Wissen verschlossen bleibt.
Ich beuge mich vor dem ehemaligen Unterlehrer von Windhaag“, sagt Adolf Exner, der Rektor der Wiener Universität, anlässlich der Verleihung des Ehrendoktorats an Anton Bruckner im Jahre 1891. Ich denke an „Das Lied von der Wirklichkeit“ von Georg Kreisler, in dem es heißt: „In der Wirklichkeit gibt’s nie Beweise, denn die Wirklichkeit, die ist wahr. Kommt mit mir auf eine wahre Reise voller Traum und ohne Kommentar. In der Wirklichkeit sind die Träume, die kein Physiker je beschreibt. Kommt mit mir in meine Zwischenräume, wo kein Mensch die Wahrheit übertreibt.“ Kreisler würde heuer seinen 100. Geburtstag feiern. 2024 begeht Bruckner seinen 200. Geburtstag. Zweifellos eine gute Gelegenheit, uns mit ihm und uns auseinanderzusetzen, uns in die Zwischenräume zu begeben, dort, wo Nähe und Wirklichkeit stattfinden können. Nähe. Schon die Kürze des Worts lässt kaum Raum zur Distanz. Zeiten der Unsicherheit räumen uns das Recht zum Zweifel mindestens so ein wie die Besinnung darauf. Die Kunst legt uns das Menschliche, das Mögliche nahe. Sie erinnert uns daran, sie kann uns näherbringen. Bruckner macht es uns möglich. „Fantasie ist nichts für die Experten, die das Leben fürchten und den Tod“, so Georg Kreisler und mehr als ein Grund zum Feiern!


Das Ortsübliche ist nie das Mögliche!
NORBERT TRAWÖGER findet, dass wir uns jenseits des Gewohnten mehr für uns anstrengen sollten.
Das Leben ist schön, macht aber viel Arbeit
Das Leben ist schön, macht aber viel Arbeit H inter meinem Rücken bin ich zu einem eifrigen Menschen geworden, „udaungs“, wie meine Mühlviertler Ahnen gesagt hätten. Im Vergleich zu ihrem existenziell notwendigen Fleiß ist meine Emsigkeit natürlich ein Witz. Auf dem Sterbebett hatte die Großmutter meine Hand in die ihre genommen und gestreichelt, sie fuhr überrascht über die Schwielen. „Du bist ja doch eine für die Arbeit!“, sagte sie, und ich wagte nicht zu bekennen, dass die Hornhaut bloß vom Freizeitvergnügen in der Kletterhalle stammte.
Heute leistet mir die Sporthaut gute Dienste, ich kann die Gemüsebeete umstechen, ohne Blasen zu bekommen, ich schaufle reichlich Kompost in die Scheibtruhe, ich schraube ohne Handschuhe einen windschiefen Zaun zusammen, damit mir die Nachbarhunde nicht die Welpin sekkieren. Auch die Fußmaschine läuft rund, damit lässt es sich den ganzen Tag durch das Tote Gebirge stapfen. Was ich nicht leisten kann: 40 Stunden arbeiten. Ich schaffe mal 20, mal 60 in der Woche, selten 12 an einem Tag, aber einem Betrieb, einem Menschen, einer Sache genau 40 Stunden zu dienen, dafür ist der Geist nicht willig und das Sitzfleisch zu schwach. Selbstständige Arbeit kann auch recht unbequem sein, aber darüber zu jammern ist ungefähr so zielführend wie die Klage, dass es doch recht steil zum Großen Priel hinaufgehe.
Damit wir uns recht verstehen: Das hier wird nicht das verwöhnte Plädoyer einer verwöhnten Frau, sich doch bitte auch ein freies Erwerbsleben zu gönnen. Nichts wäre zynischer angesichts Hunderttausender Arbeitssuchender, angesichts Zehntausender in eine ausbeuterische Scheinselbstständigkeit Gezwungener oder angesichts der Überforderung von Pflegekräften, Lehrer*innen oder Putzfrauen. Es ist übrigens nicht deren Leistung, die sich laut neoliberalen Politfunktionär*innen wieder lohnen soll, sondern die „Arbeit“ jener, die hauptberuflich die Notstandshilfe kürzen und Arbeitslose demütigen. Dabei müsste in einer halbwegs fairen Gesellschaft das Geld ja wie ein warmer Mairegen auf alle herabregnen, die uns die Kinder erziehen und die Eltern pflegen und die Regale vollräumen. Das ist nicht das Plädoyer für ein Recht auf die Faulheit für Privilegierte. Die Steuerflüchtlinge und Scheinrechnungssteller*innen – und da sind wir uns einig, oder? – sind es ja, die in unserer sozialen Hängematte schmarotzen.
Das hier ist eine Brandrede gegen die fahrlässige Verschwendung von Lebenszeit – von eigener, und noch schlimmer: von der Lebenszeit der Mitmenschen. Wer gerne 60 Wochenstunden für ein Unternehmen oder eine Idee brennt, ist beneidens- und lobenswert. Wer aber ausbrennt, sind jene, die keinen tieferen Sinn in ihren Aufgaben sehen, oder die sie nicht sinnvoll ausführen können. Ein Burnout droht jenen, die unter gewaltigem Druck stehen, aber nicht von der Stelle dürfen – in der anachronistischen Benzinwelt steht der Begriff „Burnout“ für die dumme Übung, im Stand den Motor so hochzujagen, dass die Reifen stehend in Rauch aufgehen. Das Bild eignet sich zum Vergleich.
In diesem Sinn: Runter von der Bremse! Lasst uns hackeln! Verausgaben wir uns! Gibt es Besseres, als sich in eine Aufgabe zu vertiefen und rundum alles zu vergessen? Es gibt Millionen von euch da draußen, die bessere Hundezäune bauen, die kühnere Bergtouren wagen, die gescheitere Texte schreiben als ich – und Milliarden, die mit Freude und Talent pflegen, reinigen, konstruieren, lehren. Dieses ewige Maulen über die Faulen, ich mag es nicht mehr hören. Die paar Lumpis tragen wir mit unserer Tüchtigkeit doch locker mit, genauso wie wir mit Stolz alle unterstützen sollen, die aus guten und schlechten Gründen nicht hackeln und tschinäullen können. Es braucht keinen himmlischen Vater, der seine Vögelchen nährt, obwohl sie nicht säen und ernten (Pardon, aber hier irrte Jesus übrigens, denn ohne Tannenhäher keine Zirbe!). Ich mag nur nicht mehr jene schmerzbefreiten Arbeitgeber mittragen, die aus kaltem Effizienzdenken ihre Mitarbeiter*innen in monatelange Krankenstände treiben. Eine dümmere Vergeudung will mir nicht einfallen.
Wer am Stahlkocher schwitzt, soll weiter gut bezahlt werden, wer unsere Großmütter aus dem Bett hebt, sowieso. Und wir Büro-Ponys sollten unsere Leidenschaften nicht für Hobby und Pension aufsparen. Ist es nicht eine gewaltige Verschwendung, was wir da in der Arbeitswelt anstellen, dieses sehnsüchtige Warten auf Wochenende, Urlaub, Pension? Bis dahin erledigen wir das Aufgetragene so, wie man uns früher zum Mathematiklernen vergattert hat, indem wir ein Micky-Maus- ins HÜ-Heft klemmen und heimlich lesen, damit die Mama eine Ruh’ gibt. Der Begriff „Boreout“ ist mittlerweile fast so bekannt wie sein vermeintliches Gegenstück „Burnout“: Die Betroffenen überkommt das beklemmende Gefühl, schon zu viel Lebenszeit sinnlos in leere Abläufe investiert zu haben. Starre Konstrukte zermürben. Leider löst der Trend zum Home Office das Problem auch nicht automatisch – vom Verschmelzen von Arbeit und Freizeit kann ich lange Lieder singen.
Wir verkaufen einen schönen Teil unseres Daseins. Ich bin gewiss die Letzte, die eine schnelle Lösung für die Befreiung aus Hierarchien und für den Weg aus den Sackgassen der Arbeitswelt parat hat. Aber ein wenig über den eigenen Zugang nachzudenken schadet nie. Etwa, dass wir ausblenden, wie viel von allen Seiten von uns verlangt wird. In der Rush Hour des Lebens laufen wir Gefahr, uns auf die schlechteste Art zu verausgaben. Die Kinder wachsen im Mairegen in den Himmel und brauchen neue Schuhe, und der Mairegen rinnt durch die Dachluke, und die Eltern haben im besten Fall ein Computerproblem, im schlechtesten brauchen sie eine 24-Stunden- oder eine Grabpflege. Uff, aber nur noch drei Wochen bis zum Wellnesswochenende, und einen Abend pro Woche nimmt uns der Mann die Kinder eh ab, damit wir Pilates machen können, damit wir nicht schiach werden und sich der Mann eine andere sucht, und damit wir am nächsten Tag wieder schmerzfrei vor dem Computer stillsitzen können. Wer an sich selbst arbeitet, kann mehr leisten! Und haben wir uns nicht selbst verwirklicht? Das ist auch so ein Irrtum aus den 1990ern. Mach’ dein Ding, gib’ dein Bestes, dann kannst du alles werden! Wenn der Erfolg individualisiert wird, gilt das natürlich auch für den Misserfolg. Und dass du erschöpft bist, liegt an dir. Ich kenne etliche Frauen, die sich auf Long Covid untersuchen haben lassen, weil sie immer so müde sind, und weil es nicht sein kann, dass es das System ist, das sie erschöpft.
Lasst uns bitte so faul wie nötig sein, in der Muße liegt die Kraft. Aber hören wir auf, uns durch lustlos absolviertes Yoga und Achtsamkeitsseminare fit für eine Arbeitswelt zu machen, die es wert ist, unterzugehen. Ohne ein Minimum an Leidenschaft mag ich nicht mehr dahinleben, und ich will, dass andere davon profitieren (etwa in dieser kleinen Brandrede gegen fiese Arbeitsbedingungen). Wir müssen die Aufgaben, die uns das Leben stellt, viel gerechter verteilen. Es ist nicht zu ertragen, dass sich in der sogenannten „Dritten Welt“ schon die Kinder krumm schuften müssen, nur damit wir beim Hofer Gartenmöbel zu Schleuderpreisen kaufen, auf denen wir uns von den Zumutungen der eigenen ungeliebten Arbeit zu entspannen versuchen. Es wird eben alles ein bisschen teurer, dafür weniger scheiße. Lohn muss mehr als ein Schmerzensgeld dafür sein, dass wir unseren Körper 38,5 Stunden ins Büro setzen.
Wenn ich in Sachen Lebenserwartung Kind meiner Eltern bin, habe ich jetzt noch maximal 30 Jahre, und die mag ich nicht mehr verschwenden. Denn das Leben ist schön und es macht viel Arbeit.


Tanzen möchte ich!
Wie die Zeit vergeht, ist ein oft getaner Ausruf der Verwunderung über den Lauf derselben. Gerade ging ich noch in die Schule, trug mein frisch geborenes Kind im Arm und hatte deutlich mehr Haare am Kopf, was den Rest nicht hindert, jeder Art von Zähmung die immer breiter werdende Stirn zu bieten. Meine Großeltern sind Jahrzehnte tot, wenn auch kein Tag vergeht, an dem ich sie wie einige mehr verschwundene Menschen im Sinn habe und vermisse. „Es ist mein tiefer Glaube, dass die Toten nicht tot sind, solange wir leben“, lese ich beim verehrten Universaldenker Alexander Kluge, der am Valentinstag neunzig Jahre alt geworden ist. Seit fast vierzig Jahren spiele ich mit meinem über neunzig Jahre alten Organistenfreund. Im Alter von zwölf, dreizehn Jahren habe ich die Seiten gewechselt. Bis dahin galt ich als aufstrebender Ministrant, dem künftige Führungspositionen zugetraut wurden. Es kam anders, der Organist nahm den angehenden Flötenspieler unter seinen Fittichen auf die Orgelempore mit. Ich habe nicht nur die Seiten, sondern auch die Perspektive gewechselt. Noch heute fahre ich alle heiligen Zeiten, sie sind es mir wirklich, in meinen Heimatort, um mit ihm zu musizieren. Ich habe wenige so leidenschaftliche Musiker wie ihn kennengelernt. Er nimmt sein Amateursein ernst und liebt, was er tut.
Ich frage die Urgroßmutter meiner Töchter, sie wird in drei Jahren hundert, was sie gerne tun würde: „Tanzen möchte ich noch einmal!“, antwortet sie mir ohne Nachdenken mit verschmitztem Lächeln und ihre Augen leuchten wie die ihres jüngsten Urenkelkinds, das mehr als neun Jahrzehnte nach ihr das Licht der Welt erblickte. Seit zwei Jahren befinden wir uns schon im pandemischen Ausnahmezustand, der nicht und nicht ein Normalzustand werden will, an den wir uns, nicht nur aufgrund der häufig wechselnden Verordnungen, nicht gewöhnen könnten. Erinnern Sie sich noch, wie vor gut zwei Jahren die ersten Meldungen über eine Viruserkrankung laut geworden sind? Vielleicht glaubten Sie auch wie ich, China sei weit weg. Das mitteleuropäische Verständnis, weitgehend verschont von Erschütterungen aller Art zu sein, war ein unhinterfragtes Selbstverständnis. Und wir sind längst dabei, dieses weiterhin für uns in Anspruch zu nehmen. Erinnern Sie sich an die leeren Straßen, die Stille, die im ersten Lockdown über unseren Städten lag? Mir ist erst vor kurzem aufgefallen, dass ich einige mir sehr nahe Menschen, die nicht ums Eck leben, seit über zwei Jahren nicht leibhaftig gesehen habe. Der Schein der virtuellen Welt trügt mitunter.
Alles recht und schön! Sie fragen sich vielleicht, wo will er hinaus? Ich kann Ihnen versichern, dass Sie mit dieser Frage nicht allein sind. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert, wenn sich der Nebel lichtet, sich die Trübungen der Pandemie am Boden abgesetzt haben und sedimentieren? Welche Spuren werden wir vorfinden? Und dabei bleibt die Frage, ob die Pandemie wirklich schon zu Ende geht? Was kommt im Herbst? Kommt nach der Pflicht die Kür, mit oder ohne Pflicht? Die Kür von was? „Was machst du gerade?“, frage ich meine fünfjährige Tochter bei einem Anruf. „Ich telefoniere mit dir!“, reagiert sie verdutzt. Wenn Klugheit ein Alter hat, ist sie mit Sicherheit um vieles älter als ich.
„Man kann dem Leben nicht mit auswendig Gelerntem begegnen“, sagt der Volksmund, aber mit Wachheit für die Gegenwart. Schon im Jahr 2019 waren laut Statistik Austria 1.472.000 Menschen oder 16,9 Prozent der Bevölkerung in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Einkommensarmut, erhebliche materielle Einschränkungen oder geringe Erwerbseinbindung sind nach der Definition des EU-Sozialziels Merkmale dieser Gruppe. Dass diese Gruppe in den letzten Jahren mit Sicherheit nicht kleiner geworden ist, braucht nicht erwähnt zu werden. Wie wichtig der Zugang zu Bildung, zur Anstiftung eines Forscher*innendrangs ist, zeigt die Gegenwart deutlich. Wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, dem hoffentlich bald ein postpandemisches folgen wird, doch am nahen Horizont – zumindest glauben wir uns noch in der Distanz – warten schon die nächsten Herausforderungen wie die Klimakrise auf uns. Was hier in ein paar Sätzen hingeschrieben steht, sind konkrete Probleme, die für viele von uns die der anderen sind. Vor lauter Bäumen sehen wir den Wald nicht, den wir ohnehin nicht erblicken wollen.
„Das wird ein Nachspiel haben!“, hört man oft als Drohung, wenn etwas schiefgelaufen ist. Bemerkenswert finde ich, dass es gerade dann zu einem Spiel kommen soll, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Die Erfahrung zeigt, dass die Spielplätze aller Arten im Ernstfall versperrt werden. Vielleicht liegt darin unsere Chance, die Plätze des Spiels, der Fantasie, des Singens, Tanzens, Staunens ernster zu nehmen. „Jeder ist jemand!“, wie es George Tabori auf den Punkt gebracht hat, ist dabei eine wichtige Erinnerung. Wer staunt, liegt niemals falsch, denn es gibt kein falsches Staunen im richtigen Leben. „Es würde den Gesetzen guttun, wenn sie gesungen werden könnten“, darf ich mich einmal mehr auf Alexander Kluge berufen.
Ob singend oder einfach miteinander ins Gespräch kommend, wollen wir uns auch im Frühjahr im Kepler Salon vielen Fragen stellen. Das Spiel liegt mir nahe, daher lade ich Sie zu einem Spieleabend (4. April) in den Zirkus des Wissens ein. Die Zusammenarbeit mit diesem zauberhaften Spielort der Johannes Kepler Universität Linz und seinem Zirkusdirektor Airan Berg wollen wir immer wieder intensiv leben. „Likest du noch oder lebst du schon?“, fragt die Digital-Detox-Coachin Christina Feirer (11. April) und erklärt mit Know-how, Empathie und Witz, warum Apps in unserem Hirn das Belohnungszentrum aktivieren, welche Urinstinkte Likes in uns wecken, und zeigt, wie das Dauerfeuer an Nachrichten und Informationen auf uns wirkt. „Wagners Dunkelkammer“ hat sich zu einem ungeheuer wichtigen und wirksamen Format in unserem Programm entwickelt. Karin Wagner bringt gemeinsam mit Gästen Licht in Vergessenes und Verdrängtes. Am 25. April rückt Jürgen Pettinger das Schicksal von Franz Doms in den Blickpunkt und thematisiert, was es bedeutet hat, „Schwul unterm Hakenkreuz“ gewesen zu sein. Mit der Kultur- und Sozialanthropologin Bettina Ludwig sind wir unserer Zukunft auf der Spur (2. Mai): Sie nimmt uns mit zu Jäger-Sammler*innen-Gesellschaften, in denen Zeit, Besitz und Hierarchien anders funktionieren, als wir es gewohnt sind. Aus dem Blick zurück entwickelt Ludwig eine Vision für eine Gemeinschaft, in der Diversität der Normalfall ist, und bricht damit eine Lanze für Optimismus und eine gute Portion Realismus. Der Linzer Kurator und Buchdesigner Gottfried Hattinger führt mit seinem „Maschinenbuch“ (16. Mai) in ein Reich der mechanischen Fantasie, das zeigt, dass dieses nicht nur von Künstlern und Ingenieuren bevölkert wird, sondern am Rande auch von Göttern, Teufeln, Dichtern und Philosophen, Utopisten, Scharlatanen, Betrügern, Kurpfuschern und Fantasten. Nicht zufällig erscheint das Buch anlässlich der Ausstellung „Weltmaschine“, die im Offenen Kulturhaus bis 15. Mai zu sehen ist, zum 450. Geburtstag von Johannes Kepler. In der Persönlichkeit Keplers vereinen sich neben mathematischem Genius Imaginationskraft, Experimentierlust und visionäres Denken, das auch literarische Utopie nicht ausschließt. Unseren Namensstifter bringt uns auch Erich Meyer „ganz privat“ (13. Juni) näher. Dieser Abend ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Reihe zu Johannes Kepler, die uns noch das ganze Jahr begleiten wird. Begegnen Sie im Kommenden noch Elisabeth Schweeger, Christine Haiden, Kurt Kotrschal und vielen anderen mehr. Wir bleiben dran an vielen Fragen und dabei vor allem an uns!
Widerstand wider Willen
Ab 18 Uhr finden neunzehn Hinrichtungen statt“, notiert Monsignore Eduard Köck am Morgen des 7. Februar 1944 handschriftlich in seinem Diensttagebuch. Er listet die Namen jedes einzelnen Todgeweihten auf, die jeweilige Religionszugehörigkeit, die Gründe, warum sie hingerichtet werden sollen, und sogar die geplante Reihenfolge. An diesem Montag sind es sechs Soldaten wegen Fahnenflucht, sieben Männer wegen Wehrkraftzersetzung, drei, weil sie einer kommunistischen Widerstandsgruppe angehört hatten, zwei wegen Mordes und einer – mit gerade einmal 21 Jahren der Jüngste an diesem Tag – wegen „Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts“. Franz Doms, so heißt der schwule junge Mann, sollte als Fünfzehnter an diesem Abend an der Reihe sein. Trotz seines jugendlichen Alters hat er schon mehr Hafterfahrung als alle anderen, die am Abend mit ihm zum Schafott geführt werden sollen. Die letzten vier Jahre seines Lebens hat er fast ausschließlich in Kerkerzellen oder Untersuchungshaftanstalten verbracht. Als siebzehnjähriger Bursche wurde er zum ersten Mal verhaftet. Nachbarn hatten ihn angezeigt. „Der Hitler kann hundert Jahre alt werden, wenn er glaubt, er bringt mich zum Arbeitsdienst“, soll er im Streit zu seiner Schwester gesagt haben. Führerbeleidigung konnte ihm zwar nicht nachgewiesen werden, aber in der Auseinandersetzung soll auch das Wort „Warmer“ gefallen sein – drei Monate Haft für den Jugendlichen. Die Kriminalpolizei hatte es vor allem aber darauf abgesehen, andere Namen aus ihm herauszubekommen. Franz Doms erwies sich diesbezüglich allerdings als harter Knochen. Nicht einmal Schläge, Schlaf- und Nahrungsentzug oder Waterboarding führten zum Erfolg. Ein besonders dienstbeflissener Beamter organisierte eines Tages sogar Lokalaugenscheine. Obwohl aus Kriegsgründen bereits möglichst kein Benzin mehr verbraucht werden sollte, wurde Franz Doms durch ganz Wien kutschiert, um wenigstens zu zeigen, wo er sich mit den Männern getroffen hatte. Auch das allerdings nichts mehr als Spritverschwendung. So lebte in einer von Franz Doms eindeutig identifizierten Villa in Rodaun schon lange nur mehr eine alleinstehende Witwe, keine Spur von einem Homosexuellen. Eine von Franz Doms „mit allergrößter Sicherheit“ wiedererkannte Zinswohnung im dritten Bezirk in Wien war schon seit Jahren versiegelt, in ihr hatte ein Jude gelebt, dem die Flucht gelungen war. In den Ermittlungsprotokollen trieft der Frust der Beamten über den jungen Schwulen, der nicht zu knacken war, regelrecht heraus.
Nach drei Freiheitsstrafen, darunter ein Jahr schwerer Kerker, attestierte ein Staatsanwalt Franz Doms schließlich, dass von einer weiteren Freiheitsstrafe keine Besserung mehr zu erwarten sei. Erst jetzt, um sein Leben zu retten, gab er ein paar Namen bekannt. Allesamt von Kontakten, für die er ohnehin schon einmal verurteilt worden war. Trotzdem wurde der damals 20-Jährige „als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher wegen Unzucht wider die Natur“ zum Tode verurteilt. In einem Beschwerdebrief schreibt er wenig später, schon in der Todeszelle sitzend, dass man für ein und dieselbe Tat nicht zweimal bestraft werden könne. Sämtliche Gnadengesuche wurden dennoch abgelehnt.
Seine letzten Stunden verbringt Franz Doms gemeinsam mit dem 30-jährigen Stefan Rambausch und dem 49-jährigen Leopold Hadaček in einer sogenannten „Armesünderzelle“, wo die Todgeweihten noch Papier und Stift erhalten, um einen Abschiedsbrief zu schreiben, und der Pfarrer ihnen letzten Beistand leistet. Im Diensttagebuch von Monsignore Köck ist verzeichnet, dass Franz Doms die Sterbesakramente erhalten habe und die beiden anderen als Atheisten um die Absolution gebeten und bekommen haben. Am Abend wird dann einer nach dem anderen abgeholt. Alle paar Minuten hallt ab 18 Uhr das dumpfe „Wumms“ des herabfallenden Fallbeils durch die Gänge und Stiegenhäuser des Wiener Landesgerichts. Um 18 Uhr 42 ist Stefan Rambausch an der Reihe. Er war Hilfsarbeiter bei den Hermann-Göring-Werken in Linz und hatte seinen Kollegen immer wieder prophezeit, dass der Krieg für Deutschland bald verloren sein und die Verantwortlichen dann an die Wand gestellt werden würden. Laut Gerichtsurteil „nicht nur ein gelegentlicher Meckerer, sondern ein systematischer Hetzer“. Leopold Hadaček war Maschinenarbeiter in Niederösterreich und überzeugter Kommunist. Er musste um 18 Uhr und 44 Minuten sterben, weil er eine Widerstandsgruppe gegründet, Kameraden angeworben, Schulungstreffen organisiert und Geld gesammelt hatte. Als Letzter wird Franz Doms um 18 Uhr und 46 Minuten aus der Armesünderzelle geholt und getötet. Nur eine Stunde dauert es, bis alle neunzehn Menschen tot sind. Pfarrer Eduard Köck schreibt: „19 Uhr: Einsegnung der Hingerichteten.“
Der Hinrichtungsraum im Wiener Landesgericht existiert noch heute. Dort, wo das Fallbeil gestanden ist, ist im Boden ein großer Abfluss für das Blut der Ermordeten eingelassen. Auch die originale Verfliesung und der Wasserhahn, wo der Schlauch zum Ausspritzen nach jeder Hinrichtung angeschlossen war, ist noch da. Heute wird in dem gespenstischen Raum der vielen Opfer der NS-Justiz gedacht. „Niemals vergessen – seid wachsam!“, steht auf einer großen Messingtafel. Wie im Diensttagebuch des Oberpfarrers Eduard Köck vor 78 Jahren mit krakeliger Handschrift sind die Namen jetzt in goldenen Lettern aufgelistet. Darunter Stefan Rambausch oder Leopold Hadaček. Der Name Franz Doms fehlt bis heute. Er und die beiden Mörder sind die Einzigen aus der Liste der neunzehn Todeskandidaten vom 7. Februar 1944, an die nicht erinnert wird. Homosexualität war genau wie Mord sowohl vor als auch nach dem NS-Terror strafbar, die jeweiligen Gesetze waren keine Erfindung der Nazis und die Urteile – so der Gedanke – daher kein Unrecht im eigentlichen Sinn.
Schwule Männer, die überlebt haben, wurden 1945 nicht etwa vielfach befreit, sondern einfach von den Vernichtungslagern direkt wieder in Gefängnisse überstellt, um dort ihre Reststrafen abzusitzen. Nazi-Urteile hin oder her, Schwulsein war ein Verbrechen.
In der Zweiten Republik wurde nicht nur der § 129, „Unzucht wider die Natur“, unverändert übernommen, es wurde auch die Verfolgungspraxis der Nazis einfach fortgesetzt, obwohl es die davor gar nicht in der Form gegeben hatte. Galt vor den Nazis vielfach der Grundsatz „Wo kein Kläger, da kein Richter“, wurde ab 1938 aktiv verfolgt, spioniert und ausgeforscht. Da es dank der Nazis die nötigen Strukturen dafür schon gab, wurden die auch nach 1945 weiter genutzt. – Hätte Franz Doms überlebt, wäre er sehr wahrscheinlich noch mehrfach von denselben Polizeibeamten verhaftet und denselben Staatsanwälten und Richtern verurteilt worden. Wie viele Tausende andere Männer auch.
Erst im Jahr 1971 wurde das Totalverbot von Homosexualität unter Bruno Kreisky und Justizminister Christian Broda aufgehoben. Franz Doms wäre 50 Jahre alt gewesen. 83 Jahre alt hätte er werden müssen, um 2005 offiziell als NS-Opfer anerkannt zu werden. Die erste offizielle Entschuldigung eines Regierungsmitgliedes durch Justizministerin Alma Zadić für die Verfolgung Homosexueller in der Zweiten Republik hätte er letztes Jahr als 99-Jähriger wohl nicht mehr erlebt.
Die Namen von Franz Doms und vielen anderen schwulen, lesbischen, bisexuellen oder transidenten Menschen müssen endlich aus dem Vergessen geholt werden. Queere Menschen entscheiden sich nicht für Widerstand, dennoch betreiben sie ihn aktiv. Franz Doms ist ein Vorbild, ein Held. Ehre ALLEN Opfern!

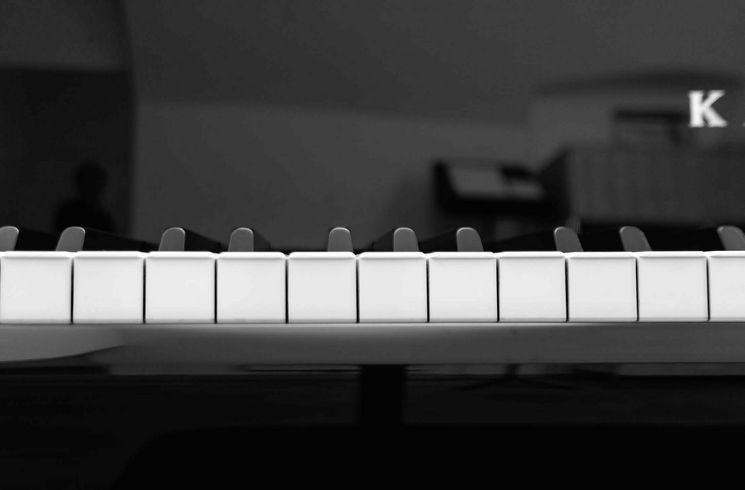
Selbstbestimmt fremdbestimmt
Noch nie galt dem Menschen seine Autonomie so viel wie zu unserer Zeit. Wer kann, hält sich mit Verbindlichkeit zurück. Eine Verabredung zum Familientreffen zum Wochenende? Hängt davon ab, wie das Wetter wird. Könnte sein, dass ein Mountainbike- Trail dann attraktiver ist als Kaffee und Kuchen mit den Blutsverwandten. Eine Abendveranstaltung im beruflichen Kontext? Anmeldung ja, aber wenn mir kurzfristig was anderes wichtig ist, muss ich mich doch nicht hinquälen. Pech für den Veranstalter. Die Selbstbestimmung wird zum kleinen Hausaltar. Auf dem man sich in der Regel selbst beweihräuchert. Das verschiebt gesellschaftlich einige bisher gültige Grenzen.
Banales Beispiel: Durch die Pandemie mit ihren Hausarresten verstärkte sich der Wunsch, ins Grüne zu wechseln. An sich kein Problem, wären da nicht einige besondere Verhaltensweisen. Ein Jäger entdeckte auf der Suche nach seinem Rehwild biwakierende Zeitgenossen im Wald. Die Tiere hatten angesichts der Eindringlinge das Weite gesucht. Diese suchen das Besondere, selbstverständlich für sich selbst. Ersucht die Waldaufsicht Wanderer, Radfahrer oder Waldbader, auf den ausgewiesenen Wegen und Flächen zu bleiben, sind sie vor tätlichen Übergriffen nicht mehr sicher. Was man als Allgemeingut sieht, definiert das Individuum. Solange es sich um den Besitz der anderen handelt, versteht sich. Der invasive Zugang in die Sphären anderer erspart sich die Mühe des Aushandelns, Abgleichens, Vereinbarens. „Das steht mir zu“, wiegt schwerer. Die Frage, woher sich diese Gewissheit ableitet, kennt nur den kurzen Weg zu sich zurück. „Weil es meine Freiheit ist.“ Mag sein, dass wir im Pendelschlag der menschlichen Entwicklungsgeschichte gerade an jenem Pol sind, der den über Jahrhunderte gepflegten Unterordnungen des Einzelnen unter das Gemeinsame gegenüberliegt. Wir haben gelernt, „ich“ zu sagen, und das machen wir geradezu blindwütig.
Schon vor Jahren ortete die Sozial wissenschaftlerin Marianne Gronemeyer eine „angestrengte Diesseitigkeit“. Die Menschen, so ihre These, hätten nach Aufgabe des Trans zendenten, nach dem Ende der Hoffnung auf ein – möglicherweise sogar besseres – Weiterleben nach dem Tod, das Leben als letzte Gelegenheit begriffen. Was immer möglich sei, müsse man herausholen, denn nichts kommt wieder. So sei der Drang, manchmal sogar der Zwang entstanden, in die lächerlich kurzen Lebensjahre alles zu packen, was es zu erleben gäbe. Gepaart mit dem Wunsch, sich von anderen zu unterscheiden, zieht es Legionen von Individualisten zur Weltreise mit Kindern oder auch bloß ins nächste Tattoo-Studio. Wer etwas Besonderes erlebt oder auch nur hofft, es zu sein, braucht eine Bühne und braucht Publikum. Ohne das Echo, ohne Beifall, ohne Bewunderung ist die Mühe der Unterscheidung mehr Plage als Lustgewinn. Welch ein Glück, dass in den vergangenen Jahren Social Media diese Bedürfnisse schnell, einfach und quasi gratis befriedigt. A selfie a day keeps depression away. So weit, so bekannt. Doch an diesem Punkt scheint sich die Geschichte nun zu drehen. Aus der vermeintlichen Selbstbestimmung wird de facto eine Fremdbestimmung. Der Algorithmus ist stärker als jedes Ich, er zwingt es in die Knie der Anbetung. Mit Likes und Kommentaren wird gelenkt, was frei begonnen hat. Auch das wäre noch kein Problem, bliebe es eine private Narretei. Längst hat der Wunsch nach uneingeschränkter Individualität aber das Niveau einer kollektiven Täuschung erreicht. In den Echokammern der Smart-Phone- Welten entstehen neue Glaubensgemeinschaften. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Einzelnen Selbstbestimmung suggerieren, längst aber zur Fremdbestimmung geworden sind. Das ist gerade dort nichts ohne die anderen. Wem es gelingt, in der Welt der Kurznachrichten und Videotrailer genügend Follower an sich zu binden, der macht die besten Geschäfte. Die Botschaften müssen gefällig genug, glaubwürdig nahe am Bauchgefühl und aufregend einfach sein. Es hat etwas von den Methoden der längst in der Rumpelkammer der Geschichte deponierten Kirchen. Einprägsame Bilder, kurze Sprüche, heroenhafte Prediger, eine ansprechende Liturgie – das Hochamt der Fremdbestimmung hat sich ein neues Gewand gesucht. Auch das wäre als kurioses Unterhaltungsprogramm nicht weiter störend. Doch die fremdgesteuerte Selbstbestimmung unserer Tage ist in ihrer subtilen Form nicht zuletzt eine Gefährdung der Demokratie. Diese braucht informierte Zeitgenossen und solche, die im oft mühevollen Abgleich von Interessen das Eigene und das Gemeinsame verhandeln. Um das zu können, braucht es auch gemeinsame Foren. Es braucht die Fähigkeit, nicht nur den eigenen Gefühlen oder Vermutungen zu folgen, sondern sich auf einer Faktenlage zu verständigen. Die Psychiaterin Adelheid Kastner provoziert dieser Tage mit ihrem Buch über „Dummheit“. Auch wenn der Begriff nicht eindeutig zu definieren sei, könne man sagen, dass dumm ist, wer sich wider bessere Möglichkeiten nicht seines Gehirns bediene. Das suche, so man es lasse, nach plausiblen Fakten und hielte sich nicht bei vorläufigen Gefühlen auf.
„Glaubst du an Corona?“, wurde ich vor kurzem gefragt. Ich war perplex und im Moment unfähig, eine adäquate Antwort zu geben. Kann man an Viren glauben oder nicht? Ist es ein Zeichen von Selbstbestimmung, die Erkenntnisse der Wissenschaft abzulehnen und sich an Sonderpredigern zu orientieren? Während mehrfach überprüfte wissenschaftliche Erkenntnisse meist kollaborativ entstehen und daher auch nicht die Wissenschaftler an sich in den Vordergrund stellen, halten sich die Glaubenden an einzelne Personen. An deren Glaubwürdigkeit machen sie ihre eigenen Entscheidungen fest. Was selbstbestimmt wirkt, ist ängstliches Klammern. Auf das Gesamte eines Gemeinwesens gesehen, birgt das die Gefahr, wieder Führer und charismatische Manipulatoren an die Spitze zu bringen. Wer seinen Anhängern das Gefühl vermitteln kann, tatsächlich anders als die anderen zu sein, vor allem aber klüger, besser, schlauer, schöpft die Likes ab.
Fremdbestimmung, die de facto Unterwerfung ist, unterscheidet sich von jener, die sich notwendigerweise aus dem Zusammenleben mit anderen ergibt. Sie ist eine soziale Toleranz, die erlernt werden kann. Wer anerkennt, dass wir, weil wir Individuen sind, unterschiedliche Interessen haben, und zwar gleichwertig, schafft die Basis für die nächsten Schritte. Entgegen der Vorstellung einer selbstbezogenen Autonomie entsteht Respekt füreinander nur, wo jeder auch von sich absehen kann. Zuhören ist eine der Qualitäten, die sich so ausbilden. Aus ihr folgt, dass der Geist beweglich wird, dass die Gefühle fließend werden, das Wahrnehmen einen größeren Horizont als den eigenen erschließt. Das Abtreten egoistischer Interessen und Vorteile im Interesse eines gemeinsamen guten Lebens wirkt dann wie eine Einwilligung in Fremdbestimmung. Paradoxerweise ist aber gerade das ein Höchstmaß an Selbstbestimmung. Der eigene Vorteil kann wachsen, wenn es auch der aller anderen tut. Im klassischen Wirtschaftsjargon heißt das „Win-win-Situation“. Aber muss es immer Gewinnen sein? Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, einschließlich der privaten Lebensführung, hat vermutlich den Blick darauf verstellt, dass wir in erster Linie endliche und dadurch auch extrem verletzliche Lebewesen sind. Erst in der Balance von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung wird das erträglich. Wer das kleine Ego als Maß aller Dinge akzeptiert, muss auch daran scheitern.


Konzentriere Dich!
Inmitten dieser Sommertage fällt es mir gar nicht leicht, mich auf ein Thema für diesen Text zu fokussieren. Mehrere Themen bringen sich ins Spiel, die ich im nächsten Moment als irrelevant oder wenig tragfähig verwerfe. Wenn es nichts zu sagen gibt, soll es doch ein Leichtes sein, sich dem Schweigen hinzugeben, denke ich mir. Wie sehr wünsche ich mir tagtäglich, dass die vielen selbstermächtigten Expertinnen und Experten stillhalten, die von der Wohnzimmercouch aus nicht nur Fußballteams trainieren, sondern ein Impfexpert*innentum an den Tag legen, das mit vielen Meinungen und noch mehr Verschwörungstheorien gewaschen ist. Der Unterschied zwischen Meinung und Wissen ist so wenig bekannt wie der zwischen Klima und Wetter, glaube ich. Es geht aber nicht um Glauben, sondern um Wissen. Das Blatt ist leer, die Gestaltung von unserem geschätzten Grafiker Erwin Franz längst in Form gebracht, die nur mehr mit Inhalt gefüllt werden will. Der Druck eines Redaktionsschlusses wirkt meist beruhigend auf mich, da ich weiß, bis dahin ist es geschafft, da es danach zu spät wäre. Leere Seiten brauchen nicht gedruckt zu werden. Man braucht dieser Logik nur zu folgen, dann kann Druck zum Sog werden, wenn man sich hinsetzt und zu schreiben beginnt. Der Komponist Balduin Sulzer sagte: „Wenn eine Muse kommt, verjage ich sie sofort. Sie hält mich nur vom Arbeiten ab.“ Die einzig sinnvolle Inspiration sei ein Aufführungstermin. Musikerinnen und Musiker, die seine Stücke uraufgeführt haben, wissen, wovon ich schreibe. Die Tinte war oft noch nicht trocken und die Zeit zum Üben knapp. „Konzentriere dich endlich auf eine Sache!“, ist eine Ansage, die ich in jungen Jahren zu hören bekam. Ich wusste aber schon damals, dass ich am aufmerksamsten bin, wenn mehrere Dinge synchron laufen. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Dinge mich interessieren, etwas angehen. Jede, jeder ist anders veranlagt, da muss man (meist) selbst draufkommen, auch wenn es bis heute nicht normal scheint, ein vielfältiges berufliches Dasein zu leben, ohne der Oberflächlichkeit verdächtigt zu werden. „Ich konzentriere mich auf alles!“, hat Heinz Holliger – angesprochen auf seine Vielkönnerschaft – reagiert. Der 82-jährige Musikuniversalist ist als Oboist, Komponist, Dirigent, Pianist oder als Lehrer auf der ganzen Welt höchst wirksam zu erleben. Freilich kreist er in einem vor allem klingenden Kosmos (meine eigene Grundveranlagung in diesem Feld kann ich auch in diesem Text nicht verschweigen), aber die Meisterschaft, die er in so vielen klingenden Aggregatzuständen hörbar macht, ist von genialischer Einzigartigkeit. Warum mich dieser Satz berührt, ist, weil er die Konzentration in den Mittelpunkt rückt, eine Fähigkeit, die er mit seinen vielen entwickelten Talenten offensichtlich auf alles, was ihn angeht, anzuwenden vermag. Konzentration ist eine willentliche Fokussierung auf Bestimmtes, um eine Aufgabe zu lösen, um etwas zu erreichen. Zumindest die Erwachsenen brauchen offensichtlich immer einen Nutzen. Wenn wir Kinder beim Spielen beobachten, verfolgen diese nicht unbedingt einen. „Was habt ihr heute im Kindergarten gemacht?“, fragte ich vergangenen Tages meine Tochter. „Gespielt haben wir!“, antwortete sie mit verwunderter Selbstverständlichkeit. „Was habt ihr gespielt?“, fragte ich weiter. „Einfach gespielt!“, sagte sie. Da hat sie mich Erwachsenen ertappt, sofort nach dem Nutzen und Zweck zu fragen. Kinder nennen die Dinge beim Namen, nicht beim Nutzen. Wer spielt, spielt einfach. Mehr geht nicht, mehr braucht es nicht. Kinder haben das Vermögen, sich erfüllen, von den Möglichkeiten ansprechen zu lassen, ohne per se ein Ziel vor Augen zu haben oder auf eine Lösung abzielen zu müssen. Es ist ein ungeheuer wertvolles, menschliches Grundvermögen, das in jeder, in jedem von uns angelegt ist. Es heißt, den Schwerpunkt in sich zu finden. Immer öfter beobachte ich Erwachsene, die ihren Kleinkindern ihre Smartphones unter die Nase halten. Mir brennt dabei das Herz, weil damit die menschliche Souveränität, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aufs Spiel gesetzt wird. Zweijährige sitzen auf ihren Hochstühlen und starren wie betäubt auf die kleinen Bildschirme. Ihre Eltern haben ihnen dieses Narkotikum verabreicht, um in Ruhe gelassen zu werden. Ich weiß von meinen eigenen Töchtern, wie angezogen sie von diesen Gerätschaften sind und mit welcher leichthändigen Selbstverständlichkeit sie damit umgehen. Doch letztlich ist dies in dieser Absicht eine Freiheitsberaubung, die sie um die Möglichkeit des Spielens bringt. Der Spielraum ist jener Ort, in dem wir die Welt erfahren, wo Fantasie sich zu entfalten beginnt, wo das Staunen zu Hause ist. Es ist der Ort, wo man Langeweile auszuhalten beginnt, um in Eigenbewegung zu geraten. Wir müssen diese Räume für uns Menschen unter Naturschutz stellen, denn dort erfahren wir, dass die Möglichkeiten in uns liegen, die wir später im „Ernstfall“ einmal brauchen, um Herausforderungen und anderen Problemstellungen begegnen zu können. Der Ernst des Lebens – wenn es ihn denn wirklich gibt – beginnt nicht erst mit dem Eintritt in die Schule, sondern mit der Geburt. Der Ernst der Kinder beim Spielen ist ein ernster, der nicht genug ernst zu nehmen ist. Dieser Ernst zielt nicht in erster Linie auf Unterhaltung ab. Spielen heißt, die Welt und ihre Möglichkeiten zu erobern. Da geht es nicht um ein Warum, nicht um ein Was oder Wie. Zu fragen, was habt ihr heute gespielt, ist, wie danach zu fragen, was hast du heute geatmet? Spielen gehört zur Grundeinstellung des Menschen. Wir kommen alle spielbereit auf die Welt, erobern uns diese spielerisch, indem wir Dinge mit den noch zu kurzen Armen in Bewegung setzen. Etwas später ziehen wir uns den Stuhl heran, meist nicht, um auf die heiße Herdplatte zu greifen. Wir öffnen Küchenkästen, ziehen die Töpfe heraus, bauen Burgen im Sand, spielen Verkaufen mit imaginären und realen Freundinnen und Freunden oder lesen laut Bücher vor, obwohl wir noch lange gar nicht lesen können. Fürs Erzählen eigener Geschichten reicht das beobachtete Ritual, in einem Buch zu blättern. Spielen ist keine Frage des Könnens, sondern des Tuns. Es ist Zustand, Tätigkeit und eine Art von Energie. In diesem Energiefeld ist man ganz bei und mit sich, ist von sich und den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten erfüllt, die man in sich hat, um dann die zu ergreifen, die einen umgeben. Wobei diese alles andere als offensichtlich oder sichtbar sein müssen. Sich mit etwas zu beschäftigen, sich von etwas erfüllen zu lassen. Das kann alles sein. Das ist der Ernst des Lebens, der uns angeboren ist. Mit der Zurverfügungstellung eines kleinen Bildschirms wird der innere Schwerpunkt ins Außen gelenkt. Es ist eine Ablenkung, die noch dazu ohne eigenes Zutun unterhält. Es ist eine sehr teure Unterhaltung, die wir uns da leisten, denn sie geht auf Kosten eines grundlegenden Vermögens unserer Kinder. Die Fähigkeit, mit sich zu sein und vieles in sich zu finden, um mit der Welt in Dialog zu gehen. Es ist unfassbar, was damit leichtfertig, vermutlich höchst unbewusst angerichtet wird, wenn diese Möglichkeiten an elektronische Geräte abgegeben werden. Die Welt braucht diese Möglichkeiten mehr denn je, und wir Menschen erst recht.
Im Kepler Salon erwarten Sie im vierten Quartal „singende Mäuse und quietschende Elefanten“ oder die Frage, wie wir die Energiewende schaffen können. Christine Haiden bringt mit „Drei Bücher klüger“ ein neues Format in den Kepler Salon: Drei Gäste stellen je ein Buch vor, das sie in jüngster Zeit klüger gemacht hat. Sie können mit dem Inhalt übereinstimmen oder ihn gänzlich ablehnen, jedenfalls hat er sie aber angeregt, über etwas nachzudenken. Und neben vielen anderem, auf das es sich zu konzentrieren lohnt, wollen wir den 450. Geburtstag von Johannes Kepler feiern. Unser Namenspatron und prominenter Vormieter in der Rathausgasse 5 feiert am 27. Dezember seinen 450. Geburtstag, daher wollen wir ihm alle Montagabende im Dezember widmen, nicht aber vorrangig in dem Sinne, ihm und seinem Werk unmittelbar auf der Spur zu sein, sondern vor allem wie wir als Menschen des 21. Jahrhunderts mit seinem Leben, Wissen und seiner Haltung in Resonanz gehen.
Die Schatten der Vergangenheit belichten
Big Band-Signation. Die Umgebung anfangs noch unscharf. Ein älterer Herr. Mit dem nächsten Schnitt dann deutlicher sein musikbegleiteter Auftritt über eine kleine Gartenbrücke. Ein Filmstar? Die Bilder sind wohlüberlegt zusammengefügt. Sommeranzug, Krawatte, die Pfeife lässig und doch straff im rechten Mundwinkel. Man wähnt sich im Vorspann eines Samstagnachmittags-Films, wäre da nicht die Blende mit dem Wortlaut „Frost on Friday“. Der britische Journalist und Fernsehmoderator David Frost moderiert: „Baldur von Schirach, founder member of the inner court of Adolf Hitler is alive and well […].“ Zur weiteren Beschreibung als „leader of the Hitler Youth“ die Bilder eines zarten Griffs von Männerhand in frisches Blätterwerk. Ein Kind und ein Hund in der Szene; Lächeln im Gentleman-Gesicht, Abgang mit dem Kind an der Hand. Sommerinszenierung. Der liebe Junge könnte einer der Enkelsöhne Baldur von Schirachs sein, vielleicht der jüngere von den beiden? Das wäre dann der 1964 geborene Ferdinand von Schirach, der spätere Autor von Titeln wie „Verbrechen“, „Schuld“, „Tabu“, „Strafe“.
1966 nach 20-jähriger Haft aus dem Kriegsverbrechergefängnis Spandau entlassen, gab Baldur von Schirach, ehemals „Reichsjugendführer“ sowie „Gauleiter“ und „Reichsstatthalter“ von Wien, im September 1968 ein großes TV-Interview. Dies zu sehen, ist befremdlich; weich, fast singend die ersten Worte Schirachs zu Adolf Hitler: „I met him in the opera.“ Von Schärfe sein Blick, manchmal ein Lächeln um die schmalen Lippen. Die Erinnerung an Hitlers „certain shyness“ holt immer noch einen Glanz in die vielwissenden Augen, die Herrn Frost beteuern wollen, von der Deportation der Wiener Juden nichts gewusst zu haben. Gestand Schirach bei den Nürnberger Prozessen noch geschickt seine Schuld, so machte er hier dem Interviewer weiß, vieles von der Katastrophe des 20. Jahrhunderts eben nicht gewusst zu haben. Dass Frost Schirachs Schmeicheln verfällt, erschließt sich über das 40-minütige Interview, welches auf YouTube nachzusehen ist.
Seit Februar 2021 führt der Kepler Salon eine Reihe unter dem Titel „Wagners Dunkelkammer“. Es ist letztlich nicht meine „Dunkelkammer“, die an die Oberfläche bringen soll, was bis dato nicht gesehen, nicht bekannt, nicht gewusst oder zu wenig gesehen, zu wenig bekannt und zu wenig gewusst war und ist. Es ist die „Dunkelkammer“ meiner Gäste, denn sie stellen neueste Forschungsergebnisse dar oder schärfen die Konturen vorhandener Bilder nach. Mit seinen Erkenntnissen zu Baldur von Schirach war der Historiker Oliver Rathkolb (Wien) unter dem Titel „Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler“ der erste Gast der „Dunkelkammer“. In den Vorbereitungen für diese Veranstaltung sah ich David Frosts Interview. In mehreren Anläufen, denn die Erscheinung dieses Herrn mit den nivellierenden Erzählungen zur Verbrechensgeschichte der Nazis rüttelte in mir immer wieder den Impuls auf, den YouTube-Kanal sofort auszuschalten. „Neu“ ist dieses Interview nicht, doch so wie Rathkolb meint, ist es ein „Schlüsseldokument“ zu einem der führenden Köpfe der Nazi-Eliten. Es lässt sich an dieser Selbstinszenierung sehen, wie flüchtig man die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts abtun kann, indem man adressiert, dass niemand von uns unfehlbar sei und wir alle „nur“ Menschen seien. Dies wirft uns auf uns selber zurück und lässt uns in den eigenen Unzulänglichkeiten hängen bleiben. Oder auch nicht. Ein platter Trick des Herrn Schirach.
Nicht als eine Person der verurteilten Täterebene wurde der Komponist Johann Nepomuk David in der mit „Brennpunkt Leipzig“ bezeichneten zweiten „Dunkelkammer“ diskutiert, sondern als Kulturrepräsentant im NS-Staat, dessen Nähe und Distanz zum Regime differenziert ausgelotet werden sollte. Oberösterreich zeigt sich stolz auf den in Eferding geborenen Komponisten – zu Recht, mit Blick auf dessen umfangreiches Wirken und Schaffen. Davids Zeit in Leipzig wird jedoch gerade in Oberösterreich immer wieder ausgeklammert, nur pro forma diskutiert oder pauschal abgearbeitet. Dies schadet mehr, als es nützt – sowohl dem Komponisten als auch der Musikgeschichtsschreibung. Von 1934 bis 1945 wirkte Johann Nepomuk David als Lehrer am Landeskonservatorium in Leipzig, das 1941 zur „Staatlichen Hochschule für Musik, Musikerziehung und darstellende Kunst“ erhoben wurde. 1942 übernahm er dort die „kommissarische Direktion“ und somit die Leitung einer kulturbildenden Institution im nationalsozialistischen Deutschland. Der Musikwissenschafter Albrecht Dümling (Berlin), die Musikwissenschafterin Maren Goltz (Leipzig) und Matthias Wamser (Basel) als Vertreter der Internationalen Johann-Nepomuk-David-Gesellschaft machten die „David-Dunkelkammer“ zur Informationsquelle ersten Ranges. Großes Interesse kam Davids Komposition „Heldenehrung, Motette nach einem Führerwort“ für vierstimmig gemischten Chor und drei Posaunen aus 1942 zu. Das Stück ist den gefallenen Lehrenden und Studierenden der Staatlichen Musikhochschule zum Gedächtnis gewidmet und wurde 1942 in der pseudosakralen Krypta des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig uraufgeführt. Das Autograph der „Heldenehrung“ liegt in einem Privatarchiv in Stuttgart und ist der Forschung leider nicht zugänglich. Allein die Zeitungsberichterstattung zur Uraufführung lässt Rückschlüsse auf die Machart dieser affirmativen Musik zu.
Inwieweit private Zufallsfunde und der Forschung zugänglich gemachte Quellenstücke das Entstehen einer Biographie forcieren, zeigt sich an einem Bündel von 31 Briefen, welche über hundert Jahre lang unentdeckt auf einem Dachboden lagen. Die Briefe und der erste Teil der handschriftlichen Urfassung der Erinnerungen August Kubizeks an dessen Jugendfreund Adolf Hitler veranlassten den Historiker Roman Sandgruber (JKU Linz) zum Verfassen einer Biographie zum k. k. Zollamtsoberoffizial Alois Hitler, den Urheber dieser an den Straßenmeister Josef Radlegger gerichteten Briefe. Primär geht es in den Korrespondenzen um den Kauf eines Anwesens für die Familie Hitler, die Zeilen enthüllen jedoch auch bis dato unbekannte Details zur Geschichte von Adolf Hitlers Herkunftsfamilie. Die Entdeckung der Kubizek-Frühfassung ist ein Wurf, sie stellt eine bedeutende Linie zur Rekonstruktion der Linzer Zeit des Diktators dar. „Hitlers Vater. Wie der Sohn zum Diktator wurde“ titelte die dritte „Dunkelkammer“. Ausgehend von Alois Hitler rollte Sandgruber die Vater-Sohn-Beziehung und das Heranwachsen jenes Menschen auf, über den ein smarter Herr 1968 lächelnd meinte, er wäre ein wenig schüchtern gewesen. Dass diese Person für den Tod von Zigmillionen Menschen verantwortlich ist, hat dieses Lächeln absorbiert.
„Wagners Dunkelkammer“ wird auch in Zukunft bewegen. Ihre Grenzen werden erkennbar, wenn die hervorgeholten Fakten beginnen, sich im Kreis zu drehen, und Fragen nach ethischen Einschätzungen dringlich werden. So wäre doch der „Dunkelkammer“ gutgetan, jenen Knaben als Seismographen unserer Zeit mit einem die Vergangenheit und Gegenwart verschränkenden Blick einzuladen, der 1968 an der Hand seines eleganten Großvaters an einem Sommernachmittag in ein Haus ging. Sofern dies wirklich der junge Ferdinand von Schirach war. Der Jurist und Schriftsteller blitzt in meinem Kopf als Wunschgast auf. Mit ihm würde ich gerne eine Metaebene freilegen zur Diskussion, wie denn in der „Dunkelkammer“ entlang all dieser Fragen überhaupt zu diskutieren sei. Ein Diskurs mit Ferdinand von Schirach über den Diskurs zur Vergangenheit. Ein möglicher Ausblick.


Sag, wie hast du’s mit der Identität?
Es ist so einfach wie trendy, Identitätspolitik für das Versagen linker Politik verantwortlich und sich im gleichen Atemzug darüber lustig zu machen. Statt mit Macht- und Verteilungsfragen beschäftige man sich nun mit Gendersternchen und Unisex-Toiletten. Prominente Kritiker*innen wie Francis Fukuyama, Slavoj Žižek und zuletzt Sahra Wagenknecht gehen sogar so weit, der Identitätspolitik das Erstarken rechtspopulistischer Strömungen anzukreiden: Statt sich um ökonomisch Ausgebeutete zu sorgen, konzentriere man sich auf die Partikularinteressen immer kleinerer sozialer Gruppen und verliere das große Ganze aus den Augen. Statt universalistisch und vereinigend zu agieren, würde man so erst recht zu gesellschaftlicher Spaltung beitragen.
Dieser Vorwurf stimmt dann, wenn Identität als fundamental und essentialistisch verstanden wird und in weiterer Folge die daraus resultierende Gruppe als homogen. Soziale Identitäten sind aber eben nicht unbeweglich und exklusiv und entspringen auch nicht einer homogenen „Essenz“ unseres Wesens, das schon immer war und auch in Zukunft immer so sein wird. Vielmehr gilt es, Identitäten als kontextabhängig, intersektional und – zu einem hohen Grad, wenn auch nicht vollständig – wandelbar wahrzunehmen. Die eigene Positionierung als Mitglied einer Religionsgemeinschaft bedeutet eben nicht, dass man nicht auch eine geschlechtliche, nationale, sexuelle oder ethnische Identität hat, und dass diese unterschiedlichen Identitäten nicht ab und an auch in Konflikt miteinander stehen können. Verschiedene Kontexte aktivieren bestimmte Gruppenzugehörigkeiten, während sie andere in den Hintergrund treten lassen. Politische Forderungen aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe abzuleiten, bedeutet auch nicht, dass aus der Identität als Frau oder als Homosexuelle zwingend bestimmte Merkmale, Haltungen oder Einstellungen folgen müssen. Wird diese Dynamik der sozialen Positionierung aufgrund der Realität multipler Zugehörigkeiten ausgeblendet und Identität als statisch, binär und gegeben angesehen, so greifen darauf aufbauende politische Forderungen in der Tat zu kurz.
Denn genauso wie Identität und Zugehörigkeit ist auch Solidarität nicht starr und kontinuierlich. Eine vielfältige und sich immer rascher verändernde Gesellschaft bringt auch stetig wechselnde Solidaritäten hervor. Beim Ausbruch der Corona-Krise erlebte Österreich eine neue Solidarität mit älteren Menschen – der etwas unglücklich titulierten Risikogruppe. Das war in seiner konkreten Ausformung doch erstaunlich, bestimmten doch bis kurz vor Ausbruch der Pandemie hitzige Debatten über Generationenkonflikt, desillusionierte „Millennials“ und privilegierte „Boomer“ den medialen Diskurs. Dieses abrupt formierte Bewusstsein für die Notwendigkeit der Solidarisierung aus einer fast konträren Situation heraus versinnbildlicht, wie unstet und wechselhaft Solidaritäten sein können.
Der Soziologe Jörg Flecker und seine Kolleg*innen identifizieren in Umkämpfte Solidaritäten gar sieben verschiedene Formen von Solidarität, von universeller Hilfeleistung bis hin zu moralischer Verpflichtung. Ihnen allen gemein ist Nähe als Grundvoraussetzung: Um solidarisch handeln zu können, bedarf es einer vertiefenden Auseinandersetzung mit jenen, denen man seine Solidarität angedeihen lässt. Deshalb stehen hinter verschiedenen Ausformungen von Solidarität unterschiedliche Kategorien des „Wir“: Wird Zugehörigkeit national definiert, also anhand derselben Staatsbürgerschaft, oder kulturell, also anhand derselben Abstammung? Sind es wir, die Leistungsträger*innen, oder wir, die aus demselben sozialen Milieu stammen? Wir, die Frauen, oder wir, die Arbeiter*innen? Je nach Situation sind diese Kategorien fließend, sie verändern sich im Laufe der persönlichen Biografie genauso wie nach sozialem Kontext oder aufgrund großer globaler Umwälzungen wie eben einer Pandemie.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist Identitätspolitik alles andere als die banale Nabelschau einer fehlgeleiteten linken Politik. Wie wir unsere Zugehörigkeiten und daraus folgend unsere (wechselnden) Solidaritäten definieren, ist Grundlage für politisches Handeln und politische Forderungen. Mit welchem „Wir“ man sich identifiziert, zu welchem man zugehörig sein will und kann, bedingt auch die inhaltliche Positionierung. Nicht erst seit dem Jahr 2021 ist Gruppenzugehörigkeit ein bestimmendes soziales Element. Das „Wir“, in das man ein- oder aus dem man ausgeschlossen wird, entscheidet über berufliches Vorankommen, Bildungschancen, Gesundheit und Lebenserwartung, Wohnverhältnisse und Überlebenschancen in Zeiten der Krise. Identität und materielles Interesse gehen Hand in Hand.
„Identität war immer schon“, konstatiert deshalb die Soziologin Paula- Irene Villa Braslavsky und meint damit, dass seit der Moderne jede Form der politischen Auseinandersetzung ein Eintreten für bestimmte soziale Gruppen war. Die vermeintliche Neutralität, die vor der neumodischen Identitätspolitik geherrscht haben soll, gab es nie. Denn die wesentliche Frage, die hinter der Gestaltung politischer Maßnahmen steht, ist, wer als die Norm für ebendiese gilt, und wer als seine Abweichung. Lange Zeit galt der Mann als das Allgemeingültige, während die Frau als das „andere Geschlecht“ und somit als außerhalb des Allgemeinen definiert war, wie es Simone de Beauvoir in ihrem feministischen Fundamentalwerk ausdrückte. Genau darin zeigt sich auch die Ironie der Kritik an Identitätspolitik: Tatsächlich geht es Strömungen wie dem Feminismus oder Antirassismus weniger um selektive Partikularinteressen nach immer kleineren Zugehörigkeiten, sondern darum, dass Grundrechte wie Schutz vor Polizeigewalt, Recht auf Ehe und Familie oder Gleichbehandlung vor dem Gesetz allgemeine Gültigkeit erlangen, also tatsächlich für alle und nicht für eine bestimmte Identität (die bisherige, eng gefasste Norm) gelten. Aus diesem Grund sei Identitätspolitik auch besser als „Politik für Minderheiten“ zu bezeichnen, wie der Politologe Jan-Werner Müller argumentiert. Die Bewegungen, die nun verkürzt unter dem despektierlichen Banner der „Identitätspolitik“ zusammengefasst werden, eint also, dass sie für eine radikale Neudefinition des „Wir“ kämpfen – weil es eben klare materielle Vorteile mit sich bringt, Teil davon zu sein. Für das „Wir“ gelten Grundrechte, die für „die Anderen“ noch immer nicht selbstverständlich sind. Deshalb versuchen Black Lives Matter oder die Trans*Bewegung, individuelle Verwundbarkeit allgemein bewusstzumachen, daraus resultierende Verletzungen ernst zu nehmen und sie gleichzeitig zu minimieren, wie man es im Rückgriff auf Judith Shklars Liberalismus der Furcht formulieren könnte. Diese Verwundbarkeit durch Gewalt oder Ungleichbehandlung ist bedingt durch Ausschluss aus dem „Wir“, das über die rechtliche wie soziale Ordnung bestimmt.
Die mitunter schmerzhafte Debatte um Identitäten ist also deshalb so notwendig und unumgänglich, weil sie die radikale Forderung nach Überwindung von Ausgrenzung bedeutet. Identitäten bleiben bestimmend in einer Gesellschaft, in der Gruppenzugehörigkeit die eigene Verwundbarkeit oder eben Unversehrtheit – körperlich, ökonomisch und politisch – determiniert. Soziale Differenz soll weder überwunden und negiert noch betont und fetischisiert werden. Sie soll nur unerheblich für die Teilhabe am „Wir“ sein.


Es gilt die Unterlassungsvermutung!
Fehler besitzen die Eigentümlichkeit, sich einzuschleichen. Fehler können sich verheerend, lebensbedrohlich, inspirierend, amüsant oder völlig anders auswirken. Ich erinnere mich, vor Jahren einen Text über ein Konzert mit Nikolaus Harnoncourt und seinem „Concentus Musicus“ geschrieben zu haben. Telefonisch gab ich vor Drucklegung noch in breitem Oberösterreichisch einen mir wichtig erscheinenden und vergessenen Halbsatz zu Mozarts „Vesper“ durch. Am Tag darauf las ich in der Zeitung von Mozarts Vespa. Was umso lustiger war, da ich in gleichem Text und anderem Zusammenhang schon einen roten Ferrari in Stellung gebracht hatte. Ich bin sicher, dass dem hochgeschätzten Musiker in seinem reichen Künstlerleben niemals ein größerer Fuhrpark an italienischen Fahrzeugen unterstellt worden ist. Bis heute amüsiert mich die Auswirkung meiner Mundfaulheit mehr, als dass mir die offenkundige Inkompetenz peinlich ist.
Deutlich sprechen und niemals den Auslaut unterschätzen waren die Lehrinhalte. Manchmal lernt man schneller, als einem lieb ist. Gelegenheit macht Erfahrung, die nur ernst genommen werden muss, um wirksam zu werden. Sich selber nicht immer zu ernst nehmen, aber ernst genug, hilft. Auch wenn diese Gabe bei dem einen oder anderen Mitmenschen den Glauben hervorruft, dass man nicht ernst zu nehmen sei. Gelacht wird nur über die Fehler anderer. Unterschätzt zu werden ist nicht das Schlechteste. Dadurch kann man sich oft unbehelligt seiner Sache widmen und nicht den Erwartungen anderer. Es lebe die Subversion!
Fehler passieren und können gemacht werden. Ob man dabei eine aktive oder passive Rolle einnimmt, ist weniger entscheidend als die Wirkung, die die Abweichung vom Richtigen bzw. dem, was für richtig gehalten wird, auslöst. Wer macht bzw. lässt schon gerne Fehler geschehen? Wer dann sagt, ich entschuldige mich, gibt sich unbewusst selbstherrlich und macht damit den nächsten Fehler, der meist aus Unwissen passiert. Sollte die Entschuldigung ernst gemeint sein, muss man darum bitten. Dies selbstreflexiv zu tun, zeugt vielleicht davon, dass man mit sich selbst im Reinen sein will, aber bezieht in Wirklichkeit niemanden ein. Da entschuldigt man sich ein Leben lang und wird erst nach Jahrzehnten aufgeklärt, dass dies andere für einen tun müssen. Ich bitte dafür um Entschuldigung, Verzeihung oder Pardon. Unwissen schützt nicht vor Fehlern!
„Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa – durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld“ habe ich in jungen Ministrantentagen gelernt. Mit der Schuld ist es so eine Sache. Schon kramt man in der Lade, um gute Gründe für seinen Fehler zu finden. Gute Gründe sind nicht unbedingt wahre Gründe! Der Reflex im Windschatten eines Fehlverhaltens befördert oft eine überbordende Kreativität im Finden guter Gründe, eine wahre Schöpfungswut im Erfinden von Rechtfertigungen. Sich ausreden, ohne dabei eine Ausrede finden zu wollen, ist eine weit verbreitete menschliche Kunstform. Die gesteigerte Sonderform ist, Behauptungen aufzustellen, die für sich stehen, aber jeder Grundlage entbehren. Wer sich behaupten will, behauptet einfach, was das Zeug hält, und erhebt es damit zur unhinterfragten Wahrheit. Die Behauptung erhebt sich über alles.
Anderen die Schuld zu geben ist allerdings ein Leichtes, den Fremden, den Impfstofflieferantinnen, denen, die Impfstoffreste wegschmeißen wollten, den Ghostwritern wissenschaftlicher Arbeiten oder denen mit mangelndem Erinnerungsvermögen, den Müttern, die ihre Kinder so derart unmenschlich behandeln, dass sie sich wünschen, dass sie in einem sicheren Land aufwachsen, den Nichtmaskenträger* innen, denen, die keinen Abstand halten und keine Nähe suchen, denen, die hysterisch sind, Bill Gates, Donald Trump und den Tirolern (hier gendere ich bewusst nicht!), den Nichtverschwörungspraktikern, den Achtlosen, denen, die das Wir verachten und das Ich über alles stellen … Alles, was recht ist, was für eine Litanei, dürfen Sie gerne denken. Mit Recht und Gerechtigkeit ist es so eine Sache! Und es richtig zu machen und anderen recht mitunter ein Spagat, der nicht machbar ist.
Nicht selten hört man vom gänzlichen Fehlen einer Fehlerkultur in unseren Breiten. Sind wir doch ehrlich, wo Menschen zugange sind, existieren und passieren unentwegt Fehler. Wir leben in einer Fehlerkultur, nur die Fehlerumgangs- bzw. die Fehlererkenntniskultur ist sehr marginal entwickelt. Die Abweichung ist schlichtweg notwendig, um lebendig zu sein, falsch- oder erst recht richtigzuliegen. Dabei rede ich noch gar nicht von kreativen Prozessen in Kunst oder Forschung. Fragen Sie bei Einstein, Curie oder Miles Davis nach, wohin sie ohne Fehler gelangt wären. Wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Fehler sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des Treibstoffgemischs für Fortschritt.
„Keinen Gedanken verschwende auf das Unabänderbare“, schrieb Bert Brecht. Er hat recht, nicht selten beschäftigen wir uns mit Dingen, die ohnehin nicht mehr zu ändern sind. Doch noch öfter kommen wir gar nicht auf die Idee, eine haben zu können, um etwas zu ändern, für etwas aufund einzustehen. Wir machen den Fehler, erst gar nichts zu machen, weil wir gar zuschauen, wegschauen, eh nichts machen können. Die Unterlassung ist eines der größten Felder, auf dem wir Menschen Fehler machen.
Dann tritt ein siebzehnjähriger Schulsprecher namens Theo Haas auf und nennt die Dinge unprätentiös und deutlich beim Namen. Es kann nicht sein, dass sich jemand hinter dem Recht versteckt und sagt: „Wir handeln doch nur, wie das Gesetz es vorschreibt.“ Er sagt uns mit klarer, unaufgeregter Stimme, dass er „Recht muss Recht bleiben“ nicht mehr hören könne: „Wenn das Recht nicht für die Menschen und Kinder ist, muss es geändert werden. Das ist unsere Pflicht, aufzustehen und zu sagen, das geht so nicht, alles andere ist ein Fehler.“
Ich denke an die in Linz geborene Doro Blancke und ihre Flüchtlingshilfe. „Egal, wo ich bin, ob in Österreich oder im Ausland, ist es mir wichtig, den Dialog im Sinne der Menschen auf der Flucht im Auge zu behalten und Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsbrüche aufzuzeigen. Ein großes Anliegen besteht auch darin, die bewusst geschürten Ängste vor dem ‚Fremden‘ zu dezimieren“, liest man auf ihrer Website: Dafür sind Dialog, Austausch und das Kennen der Fakten von großer Bedeutung. Was sie letztendlich immer wieder antreibt, ist die Liebe zum Menschen, ihr Glaube an die Gerechtigkeit und das „Getragensein im WIR“. Theo Haas und Doro Blancke nenne ich hier stellvertretend für viele Menschen, die aufstehen, die Dinge beim Namen nennen und nicht nur das Wort ergreifen. Ihre Courage ersetzt nicht unsere eigene, aber ihr Mut erinnert uns daran und ermutigt uns im besten Fall, nicht den menschlichen Kardinalfehler des Unterlassens zu begehen.
Die Frage ist, welche Fehler darf man sich erlauben und welche erlauben wir uns einfach. Ganz unbehelligt. Es gilt die Unterlassungsvermutung!
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite


