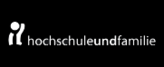Another life is possible
Die Zukunft wirkt durch Dauerkrisen wie eine einzige Katastrophe und dass es schnell zurück in die gute alte Zeit gehen kann, glaubt seit dem Krieg in der Ukraine auch niemand mehr. So wie bisher können wir aber nicht weitermachen. Das ahnen fast alle. Aber begreifen wir es auch? Ein Essay von Stephan Lessenich.
Das große Taumeln
Der Angriffskrieg Russlands erschüttert Europa. Man hätte es besser wissen können. Viele Jahre haben wir Wohlstand mit Demokratie verwechselt und hatten kein Problem mit illiberalen Politikern. Nun erfahren wir schmerzhaft, dass es so nicht weitergehen kann. Ein Essay.


Aufwachen
Jahrelang bestimmten die großen Tech-Konzerne aus den USA, wohin die Reise geht. Jetzt ist ihre Macht angezählt und China geht sowieso seinen eigenen Weg. Nutzt Europa seine Chance?
Starke Gefühle
Besser kann es erst dann werden, wenn wir wieder einander begegnen, findet Vea Kaiser. Der angebliche Generationenkonflikt sei nämlich die Äußerung eines viel tiefer liegenden Problems.

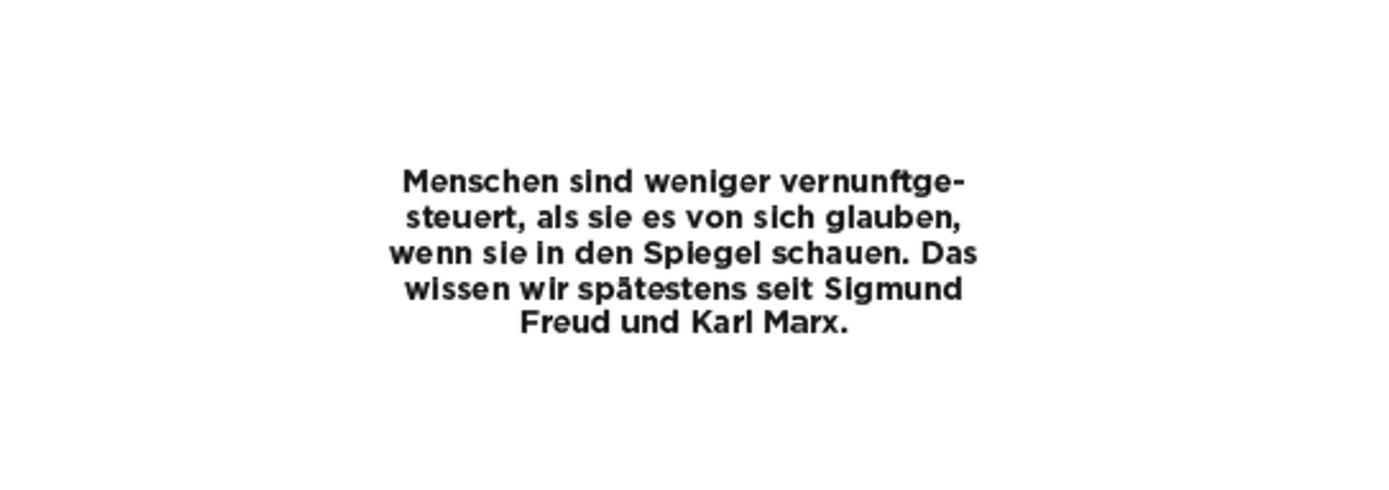
Widersprüche, wohin man schaut
Gedanken von HARALD MARTENSTEIN, warum wir die Welt gar nicht anders wahrnehmen können, als wir es gerade tun. Und warum er trotz allem Optimist bleibt.
Entpört euch!
Die Debatte darüber, was legitime Kritik und was freiheitsfeindliche Zensur ist, wird härter und aggressiver. Wie steht es wirklich um die Meinungsfreiheit? Ein Essay von JOCHEN BITTNER.
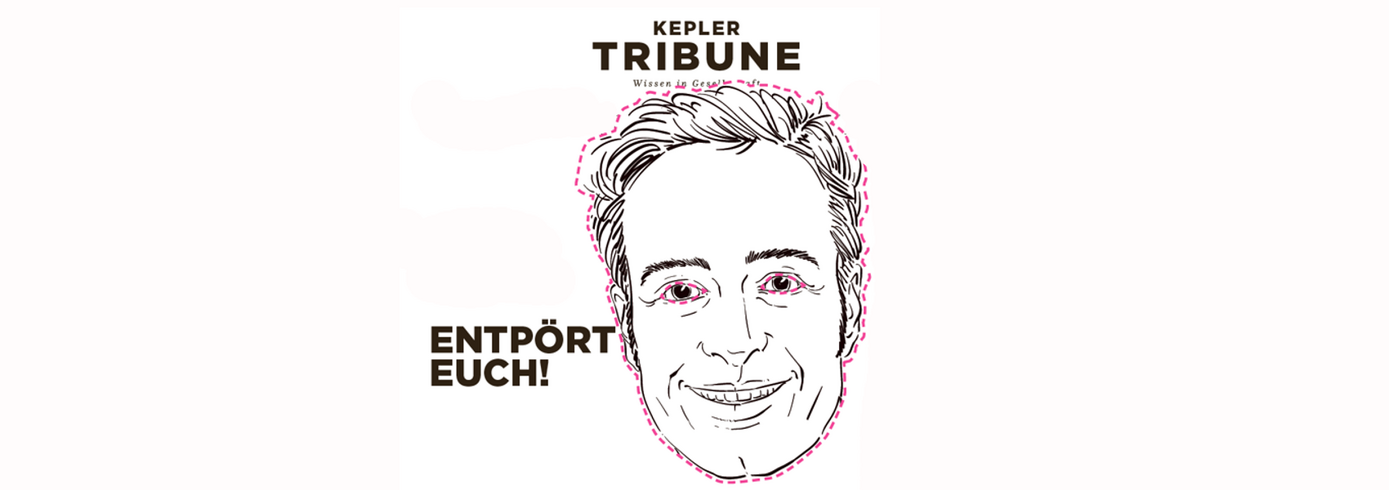

Meine Blase, deine Blase
Was ist wichtiger? Die persönliche Freiheit des Einzelnen oder doch das Zusammenleben einer funktionierenden Gesellschaft? Die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung haben diese zentrale Frage eines modernen Staates wieder einmal ins Zentrum gerückt. Jede Antwort darauf sorgt aber für neue Probleme. Verdammt. Ein Essay von Cathrin Kahlweit.
Von Lausanne lernen
Die geplante Technische Universität in Oberösterreich wirft ihre Schatten voraus. An Zurufen, Wünschen und Erwartungen mangelt es nicht. Neu, neu, neu ist das Credo. Aber wie? Ein Rückblick kann auch hier den Blick nach vorne weiten.


Die Reifeprüfung
Das vergangene Schuljahr endete mit kollektiver Überforderung. Wie stehen die Chancen, dass es besser wird? Karin Leitner über bildungspolitischen Katastrophenschutz.
Der Mensch über allem
Ohne die Wissenschaft hätte die Politik gerade wenig zu sagen. Wenn wir Glück haben, hört sie noch weiter zu. Gedanken von Susanne Schneider über merkwürdige Zeiten.


Frieden?
Ach, wie schön. Europa gedenkt wieder einmal des Friedens. Doch hinter den Kulissen brechen die Institutionen des alten Kontinents zusammen. Der Krieg läuft längst anders. Wir haben nur noch nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Ein Essay von CLAUS PÁNDI.
Universitas und Innovation
Damit Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen, Konzepte und Ideen als besonders gut und zukunftsträchtig gelten, müssen sie vor allem eines sein: innovativ. Das erscheint uns heute völlig selbstverständlich. Aus historischer Vogelperspektive ist es das jedoch keineswegs. Im Gegenteil: Mentalitätsgeschichtlich galt das Neue lange als mindestens verdächtig, oft sogar als überaus gefährlich. Und zwar vom antiken Rom, wo man mit dem homo novus abwertend einen politischen Emporkömmling bezeichnete, bis zur mittelalterlichen Inquisition, deren global agierende Agentur zur Fortschrittsvermeidung bekanntlich über unzählige Leichen ging. Peter Sloterdijk bemerkte in seinem 2014 erschienenen Buch „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“ deshalb pointiert: „Was heute als Tradition bezeichnet wird, nannte sich in älteren Tagen meistens Frömmigkeit, und was jetzt Innovation heißt, war vormals schlicht und einfach Sünde.“
Auch vor diesem Hintergrund lässt sich jene ungeheure Freisetzung von Neophilie, die im Laufe des 18. Jahrhunderts unter dem etwas groben Begriff der Aufklärung einsetzte, also kaum überschätzen. Denn von nun an gewann der ikarische Imperativ immens an Bedeutung: Ideen, Projekte und Unternehmungen sollten sich durch innovative Optimierung zu immer neuen Höhen aufschwingen. Und selbst wenn es dabei auch wiederholt zu kreativen Bruchlandungen kam, avancierte die Liebe zum Neuen zu einem zentralen Existenzwert der Moderne.
Nicht zuletzt deshalb gilt uns Leonardo da Vinci, dem anlässlich seines 500. Todestags in diesem Jahr weltweit Ausstellungen gewidmet werden, ja bis heute als der innovative Aufklärer avant la lettre, obschon seine ingenieurwissenschaftliche Schaffensbilanz eigentlich eher bescheiden blieb. Denn nur sehr wenige seiner wagemutigen Entwürfe, vom Holz-Helikopter bis zum Panzerfahrzeug, erblickten tatsächlich je das Licht der Renaissance-Welt. Und das nicht nur deshalb, weil sie oft lediglich als skizzenhafte Showreels dienten, um finanzstarke Fürsten für die Subventionierung der eigenen Existenz zu begeistern, sondern ebenso, weil ihnen mitunter hanebüchene Denkfehler zugrunde lagen, die sie zu baulichen Totgeburten machten. Doch auch wenn der Wille zur Innovation stets die Möglichkeit solch seriellen Scheiterns implizierte, brachte der neophile Fortschrittsdrang der Moderne in technologischer, sozialer und auch moralischer Hinsicht selbstverständlich ein ungeheures Maß an zivilisatorischer Verbesserung hervor. Nicht nur in den westlichen Demokratien, sondern auch global gesehen leben wir in diesen Tagen im Durchschnitt schließlich länger, hygienischer, vernetzter, mobiler, wohlhabender, sicherer, friedlicher und komfortabler als je zuvor.
Deshalb führt jede pauschale Fortschrittsskepsis heute auch zwangsläufig in die Irre. Nur ändert das wiederum nichts daran, dass die Liebe zum Neuen gleichzeitig auch blind machen kann. Blind für jene Dialektik der Aufklärung, die aus philosophischer Warte so eindringlich von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer oder Walter Benjamin beschrieben wurde; Letzterer lieferte in seinem Essay „Über den Begriff der Geschichte“ das vielleicht eindrücklichste Bild dafür.
In Rekurs auf Paul Klees „Angelus Novus“ beschreibt Benjamin einen Engel, in dessen ausgebreiteten Flügeln sich ein Sturm verfängt und den Götterboten davon abhält, die vor ihm liegenden Ruinen wieder aufzubauen. „Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ Die Drastik dieses Bilds rührt natürlich vor allem daher, dass Benjamin den Text 1940 im Angesicht jener nationalsozialistischen Barbarei schrieb, die das ganze Arsenal technologischer Innovationen in den Dienst einer historisch einzigartigen Mordmaschinerie stellte. Nichtsdestotrotz – oder gerade deswegen – gemahnt es einen aber auch heute noch, ein starkes Sensorium für die immensen Fallstricke des Fortschritts zu entwickeln.
Um derer in aller Deutlichkeit gewahr zu werden, muss man gegenwärtig ja nur nach China blicken, wo jene digitalen Technologien, die vor ein paar Jahren noch als Fanal globaler Freiheit firmierten, nun die technische Infrastruktur eines allumfassenden Überwachungsstaats bilden, gegen den George Orwells 1984 zunehmend verblasst; wobei sich die Fallstricke des Fortschritts nicht nur in solch politischen Extremfällen offenbaren, sondern etwa auch in der kürzlich bei Embryonen angewendeten CRISPR/CAS-Methode. Der damit verbundene Eingriff in die menschliche Keimbahn mag sich in Zukunft zwar womöglich als medizintechnischer Meilenstein entpuppen, könnte aber ebenso zu einer neuen Form der Eugenik führen.
Sind Fortschritt und Innovation also stets ambivalente Angelegenheiten, die zwischen zivilisatorischer Verbesserung und dialektischer Verschlechterung oszillieren, kommt gerade den Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen in diesem Zusammenhang eine doppelt wichtige Rolle zu. Zum einen sind sie es selbst, die als wesentlicher Motor von Innovationen dienen. Denn entgegen dem weit verbreiteten Mythos, das Neue entspringe vor allem den Dynamiken des Marktes, weist beispielsweise die Ökonomin Mariana Mazzucato immer wieder darauf hin, dass es von der Eisenbahn bis zum Internet auch und vor allem der Staat sowie die mit ihm verbundenen Forschungsinstitutionen waren, die die entscheidenden Neuerungen des Technikzeitalters hervorgebracht haben. Und bis heute ist es allen voran die Grundlagenforschung, ohne die sich kaum eine der digitalen Disruptionen des Silicon Valley denken lässt. Oder wie Mazzucato in ihrem 2013 erschienenen Buch „Das Kapital des Staates“ exemplarisch bemerkt: „Tatsächlich steckt im iPhone nicht eine einzige Technologie, die nicht staatlich finanziert wurde.“
Doch neben den MINT-Fächern, die für die technischen, chemischen oder biomedizinischen Innovationen sorgen, sind es auch die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, denen mehr denn je eine buchstäblich existenzielle Funktion zukommt. Nur mit ihren Mitteln können wir schließlich einschätzen, abwägen und reflektieren, wie sich bestimmte Innovationen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben auswirken, welche soziale Folgeprobleme sie schaffen und ob wir sie ethisch – man denke an die bereits erwähnte Genschere – überhaupt zulassen sollten.
Nun muss man sich freilich keine Illusionen machen: Gegenüber der brachialen Dynamik innovativer Disruptionen wirkt die philosophische oder soziologische Reflexion im öffentlichen Diskurs – leider – allzu oft wie ein machtloser Zuschauer am Seitenrand. Aber gerade das lässt sich eigentlich nur als Ansporn verstehen, sie an den Universitäten zukünftig zu stärken, und zwar nicht zuletzt dadurch, dass Forschungsprojekte interdisziplinär aufgestellt werden. Denn ganz gleich ob es um Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz, Robotik oder Biogenetik geht: Ein Fortschritt, der Fallstricke möglichst vermeidet, braucht die Verzahnung von MINT-Fächern mit Gesellschaftsund Geisteswissenschaften.


Wind of change
Die Kräne auf dem Linzer Campus geben, indem sie hoch hinauf ragen, die Richtung vor. Sie stehen dafür, dass die Sache mit dem Aufbruch vom Industrie- ins digitale Zeitalter in Linz begriffen wurde. Der Wind des Wandels ist hier angekommen, Universitäten müssen sich überall neu sortieren. Denn darum geht es: Auf Dauer wird kein Land zu einer Spitzenregion werden können, wenn seine Universität nicht in derselben Liga angesiedelt ist.
Die Johannes Kepler Universität Linz geht in diese aufregende Sattelzeit eines Epochenwandels als deklarierter Außenseiter. Innerösterreichisch kämpft sie mit dem Nachteil ihrer späten Gründung. Diese Jugendlichkeit kostet sie im Gerangel an den Hochschultöpfen hohe Summen. Daneben die nicht minder fordernde globale Ebene: Weltweit wird der Kampf um das Wissen mit den Methoden eines Rüstungswettlaufs ausgetragen, Supermächte treten gegeneinander an. Die JKU und andere von der Größe her vergleichbare Hochschulen geraten damit in die Zwänge einer Doppelmühle. Was ihnen an Masse und Substanz fehlt, können sie nur durch größere Dynamik, Einfallsreichtum, Bereitschaft zu Veränderung und offensivere Teilnahme am öffentlichen Diskurs kompensieren.
Und obwohl die Aufbruchsstimmung der Gründerjahre, gemessen an der Historie anderer Universitäten, noch nicht lange zurückliegt, bleibt kein Jahr, kein Monat, nein: kein Tag Zeit, um für eine Rückschau auf das bereits Geleistete innezuhalten.
Blenden wir zurück in diese Phase: Der Stolz des Landes auf seine junge Universität war greifbar und noch nicht zur Routine geronnen. Damals war die Welt auch nicht simpel gestrickt, sondern komplex. Es gab Wettrüsten und zugleich starre Blöcke, es gab Kreisky-Jahre und Wachstum, gesellschaftlichen Aufbruch und Veränderung, für mich als Arbeiterkind, das damals vor 40 Jahren die Linzer Universität besuchte, ganz besonders viel von dieser auf einen Schlag veränderten Lebensweise. Ich fremdelte gewaltig mit meinem neuen Dasein als Student, verstand mein Wirtschaftsstudium als lästige Etappe vor dem eigentlichen Erwachsenenleben, wollte so schnell wie möglich Geld verdienen und nach Abschluss des Studiums aus möglichst vielen guten Berufsangeboten wählen dürfen. Das war es, was mich reizte, und ich bin mit diesem Lebensplan nicht allein gewesen. „Sind wir hier richtig?“, fragten sich viele, als die erste und zweite Studentengeneration, die aus Nichtakademikerhaushalten hier in Linz an der Universität begonnen hatten. Die Bildungsmobilität von unten nach oben hatte gerade gestartet.
Wir fühlten uns frühreif als angekommen und auserwählt, und wenn ich heute daran denke, was wir damals wussten (oder besser nicht), wird mir klar, wie überheblich das gewesen ist. Die meisten von uns schalteten schnell um. Sie misch ten ihre Sprache mit Fremdwörtern auf, versteckten ihre Halbbildung hinter Akademikerjargon, nannten es „reflektieren“, wenn sie über etwas nachdachten. Unter dieser „diskursiven Ungeschicklichkeit“ leidet die Wissenschaft – nicht alleine in Linz – noch heute. Wissenschaft muss mehr denn je gesellschaftlich wahrgenommen und verstanden werden. Bei immer komplexeren Themen und Fragestellungen ist es für Lehrende wie Studierende eine echte Herausforderung, von den Menschen außerhalb Ihres Subsystems wahrgenommen zu werden.
Dabei ist unabhängig zu denken die Königstugend des Intellektuellen. Sich auf dieses Privileg zu beschränken, ohne sich öffentlich zu äußern, greift allerdings zu kurz, zumal in Zeiten, in denen Emotionen die Fakten überlagern, Populisten und Algorithmen den Diskurs bestimmen, Leute an der Demokratie verzweifeln und die Erfolge der Aufklärung gefährdet sind.
Wissen und Fakten führen ein Rückzugsgefecht. Die Universitäten und ihre Mitarbeiter müssen sich daher heute mehr denn je einmengen. Dies bedeutet auch, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wer sich öffentlich äußert, nimmt eine Gefährdung in Kauf. Aber wer sonst soll diese Rolle übernehmen, wenn nicht die Experten der Wissenschaft, wenn es darum geht, Mythen durch Fakten zu ersetzen und Vorurteile – die größte Seuche unserer Zeit – durch Wissen und Tatsachen?
Die Linzer Universität hat dabei wie alle anderen Wissenseinrichtungen eine Bringschuld und keine andere Wahl, als sich in dieser Aufmerksamkeitsökonomie deutlicher als bisher zu behaupten, will sie medial und öffentlich nicht untergehen und ihren Rang und ihre Wahrnehmung verbessern. Ihre Professoren müssen dabei über ihren engsten Radius hinauswirken. Die Fähigkeit, zu unterhalten und packen zu können, gehört dazu.
Früher war es einfacher, Gehör zu finden. Aber vielleicht ist das auch nur eine Verklärung der Hochschul-Vergangenheit. Die Hochschule hatte damals ihre Größen, deren Nachhall noch heute wirkt (von Rothschild bis Kulhavy). Politisch gab es damals alle Spielformen bis hin zu den Trotzkisten, die Haare wurden lang getragen, als ersten Computer gab es den Commodore. Und deswegen war die Welt klein, überschaubar, langsam und insgesamt in Ordnung und so ganz anders als die turbulente Gegenwart.
Es kam damals, wie es uns versprochen wurde: Ein jeder von uns Marketingabgängern bei Ernest Kulhavy konnte aus vielen Angeboten wählen. Ich blieb im Journalismus hängen und bereue es nicht und darf mich heute selbst kritisieren dafür, wie sehr ich damals verkannt habe, was eine Universität noch alles sein muss neben eben dieser Ausbildungsstätte für junge Leute, die das Studium als den besten Sparplan für ihr Leben ansehen. Denn ein Studium bringt höchste Rendite, wer vier Jahre studiert, verdient 40 Prozent mehr.
Nicht anders der Zusammenhang zwischen einer Universität und dem Land, das diese Hochschule umgibt. Hochlohnland und Spitzenregion und eine Universität, die nicht in dieser obersten Division agiert – das geht auf Dauer nicht zusammen.
Bildung war 1966, bei der Gründung der Johannes Kepler Universität, schon die heißeste Ware eines Landes und ist es heute in einer wissensbasierten Umgebung mehr denn je. Schlüsseltalente suchen Orte, an denen bereits andere Hochqualifizierte leben, weil sie am Austausch mit diesen wachsen und reifen können. 50 Prozent der US-Patente werden in vier amerikanischen Großstädten entwickelt, wo die besten Universitäten sitzen. Universitäten stehen am Beginn von sich selbst beschleunigenden Kausalketten. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Der Rest hat es schwer.
Diese Conclusio muss uns zu denken geben. Denn vier von zehn Studierenden, die in Oberösterreich geboren wurden, studieren heute außer Landes. Es ist Potenzial, das diesem Land verloren geht und fehlt. Dieser Abfluss macht sich beim Fachkräfte- und Technikermangel bemerkbar. Die Fachhochschulen, vor 25 Jahren in Oberösterreich gegründet, haben mitgeholfen, diese Lücke zwischen Bedarf und Angebot klein zu halten. Doch auch ihre Möglichkeiten sind ausgereizt. Es bleibt also keine andere Alternative, als diesen „brain drain“ zu bremsen, im Idealfall zu stoppen.
Pioniergeist, von dem wir dabei reden, war 1966 bei der Gründung der JKU als ein zentraler Faktor mitentscheidend. Ein ganzes Land hat damals für seine Universität gekämpft. Es waren Leidenschaften im Spiel und das Bewusstsein dafür, mit der Neugründung eine historische Lücke geschlossen zu haben.
Diese Leidenschaft für „unsere Hochschule“ ist Normalität im Umgang gewichen. Das Erreichte wird als selbstverständlich akzeptiert. Oberösterreich ist nach Gründung der Universität und maßgeblich durch diese aus der Epoche eines Agrar- und Industrielandes herausgetreten und hat dabei einen entscheidenden Sprung nach vorne gemacht. Zugleich leidet es bis heute unter dem Nachteil dieser späten Universitätsgründung und konnte diesen Malus nie wettmachen; und Gleiches gilt für die Landeshauptstadt Linz.
Die Daten sind eindeutig: Wien (mit seiner 1365 gegründeten Universität) zählt heute 168.000 Studierende. Das mit Linz vergleichbare Graz (Gründungsdatum 1585) kommt auf 53.000 Studierende, Graz übt auf junge Leute deshalb einen großen Sog aus. Sogar das halb so kleine Innsbruck mit seiner 1669 gegründeten Hochschule steht als Universitätsstadt über Linz, wenn wir die Studierendenzahl als Maßstab nehmen (30.000 Studierende hier, 23.000 in Linz). Linz läuft noch hinterher.
Nummer vier unter den Universitätsstädten in Österreich zu sein, das wird dem Bundesland und seiner Landeshauptstadt nicht gerecht. Es handelt sich um eine Erbsünde, an deren Beseitigung sich die Landespolitik mit aller ihr zur Verfügung stehenden Kraft abarbeiten muss. Denn die Erbsünde wirkt mit Zins und Zinseszins nach. Es handelt sich um eine föderale Ungerechtigkeit, wenn wir die Kennziffern des Landes mit jener der JKU in Beziehung setzen. Oberösterreich erwirtschaftet 18 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts, 28 Prozent seiner Exporte und zählt 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Doch es erhält nur knapp fünf Prozent des österreichweiten Universitäts-Etats. Dass wir dieses eklatante Missverhältnis schlucken, ist mit der Engelsgeduld der Oberösterreicher zu erklären, die sich in ihr Dasein als Nettozahler dieser Republik ergeben haben. Dieser Nachteil wird zur echten Gefahr, weil sich die Wissens- und Innovationsdynamik beschleunigt. Oberösterreich und Linz und die JKU haben akuten Handlungsbedarf.
Diese Ausgangslage müssen Oberösterreich und seine Bewohner vor Augen haben. An der Universität selbst wurde die Gefahr erkannt. Die Universität setzt ihren dynamischen Prozess der Weiterentwicklung fort; die Baukräne sind ein deutlich erkennbares Zeichen dafür. Der Nachteil eines Pendler-Campus, der fern vom Stadtzentrum angesiedelt ist, kann nur dadurch wettgemacht werden, dass der Campus für sich selbst ausreichend Sog entfaltet, wie es im Falle anderer Hochschulen die den Campus umgebenden Städte tun. Daher muss investiert werden.
Es geht um Sog und damit um Wissen und Talent, das angezogen werden soll. Weltweit kämpfen Länder und ihre Universitäten um dieses Potenzial, das System Uni wird global umgepflügt, die akademische Weltordnung verändert sich. Seit vor zehn Jahren die ersten Hochschulrankings erschienen sind, beschleunigt sich dieser Prozess. Linz muss sich innerhalb Österreichs als Universitätsstandort behaupten (das heißt, den historisch aufgerissenen Rückstand aufzuholen), während es in Österreichs gesamter Hochschullandschaft darum geht, im globalen Wissenswettstreit nicht unterzugehen. Linz steckt damit in einer Doppelmühle, das muss es begreifen. Und ich bin kein Schwarzseher.
Weltweit entstehen Universitäten mit neuen Betriebssystemen. Manche sparen sich die Hörsäle und erklären das Modell der Präsenzuniversität für überflüssig. Einige werden errichtet, unbelastet von historischem Ballast, wie zum Beispiel die Programmierschmiede 42 in Frankreich, die Minerva- oder Singularity in Kalifornien. China steckt Milliarden in den Aufbau einer Armada neuer Universitäten, exemplarisch dafür hat die „NZZ“ vor einigen Wochen das Beispiel Southern University of Science and Technology (SUST) in der chinesischen Metropole Shenzhen beschrieben. 2011 auf dem Reißbrett von null auf konzipiert mit vorerst 44 Studenten und 15 Millionen Dollar Budget hält SUST heute bei 5.300 Studierenden und einem Budget von 500 Millionen Dollar und ist im Ranking die achtbeste Universität auf dem chinesischen Festland. Ein Durchmarsch binnen acht Jahren. Diese Hochschulen fischen im Pool der besten Talente.
Ähnlich in Singapur, wo ich zweimal als Mitglied einer Delegation erfahren durfte, was Ausrichtung an Exzellenz bedeutet. Die dortige Nanyang Technological University wurde 1991 gegründet, sie ist heute neben dem MIT und Berkeley die anerkannteste technische Universität der Welt. Ihr Rektor, der Schwede Bertil Andersson, schenkte uns Gästen aus Österreich unverblümt ein: „Künstliche Intelligenz ist heute das heißeste Ding in der Welt der Forschung. Und wenn ich daran denke, bin ich in Sorge um Europa.“ Andersson geht davon aus, dass im nächsten Jahrzehnt asiatische Universitäten erste Filialen in europäischen Metropolen errichten werden. Dies wird das Gefüge noch einmal verändern.
Auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, so Andersson, sei zwar Microsoft die Nummer eins, aber dahinter folgen gleich neun asiatische Universitäten. Andersson gab den Österreichern eine Botschaft mit: „Eure Hochschulen werden zu nationalistisch geführt. Ihr braucht Durchmischung. Bei uns kommen sieben von zehn Professoren aus dem Ausland.“ Und es braucht andere Prioritäten.
„Has the West lost it“, fragte der Economist vor einiger Zeit und stellte die These in den Raum, dass die Überperformance Europas seit dem Jahr 1800 und der Rückfall Chinas nur eine kurze historische Verirrung darstellen. Werden wir es erleben, dass Europa als globales Zentrum ausgedient hat? Setzt sich die konfuzianische Leistungskultur durch, getragen von der Überzeugung, dass Erfolg nicht auf Talent, sondern primär auf Fleiß beruht?
Lassen wir das alles sickern und gehen wir weiters davon aus, dass sich in einer digitalen Welt die mathematisch begabten und die technologiebesessenen Talente eher durchsetzen werden, dann spricht wenig für uns. Beim internationalen TIMMS-Test, der solch einschlägige Fertigkeiten misst, landeten von 1000 koreanischen Kindern 500 in der höchsten Leistungsstufe, ähnlich in China und Singapur. In Frankreich bzw. Deutschland schafften dies gerade 20 bzw. 25 Schüler. Lassen wir die Frage nach der Messgenauigkeit solcher Tests außer Acht, so bleibt doch eine Riesendifferenz. Analytische Kompetenz, gekoppelt mit der schieren Masse an Leuten, verschafft Asien einen Extra-Kick. Was hat Europa dem entgegenzustellen? Vielleicht sein größeres kreatives Potenzial? Die ausgeprägtere Fähigkeit zur Improvisation? Oder Individualismus als Antwort auf politischen Dirigismus und Kollektivismus? Dies alles vor Augen, stellt sich die Frage danach nicht mehr, ob und wie sich europäische Universitäten anders und neu ausrichten müssen. Die Antwort ist selbsterklärend. Es geht nur noch um das Wie? Am Beginn eines solchen Prozesses müssen wohl viele Fragen stehen. Welche Talente wollen wir? Wie definieren wir Talent? Wie kriegen wir sie? Was müssen wir ihnen bieten, was andere Universitäten, denen wir mangels Ressourcen unterlegen sind, nicht bieten können? Wie können wir die geforderte Internationalität verwirklichen? Wie ein innovatives universitäres Ökosystem schaffen? Wie muss sich die Universität in das Umland einfügen, und was muss das Umland tun, um der Universität zu Attraktivität zu verhelfen?
Will die Linzer Universität in diesem weltweiten beauty-contest nicht untergehen, muss sie fortfahren, Boden in der Nationalliga gutzumachen und sich innerösterreichisch auf die Beine stellen, wie sie es die letzten Jahre bereits spürbar getan hat. Linz muss zu Innsbruck und Graz aufschließen, vor allem finanziell. Von diesem Druck können wir die Landespolitik und die Linzer Stadtpolitik nicht entlasten, auch wenn Land und Stadt zuletzt substanzielle monetäre Beiträge geliefert haben. Es handelt sich bestenfalls um Etappenziele. Denn der Nachteil der späten Geburt wirkt leider nach. Die Linzer Universität muss weiter wachsen, auch wenn Größe und Spitze einander als Begriffe widersprechen. Es gibt keinen natürlichen Plafond für die JKU. Wenn ein neues KI-Studium angeboten wird und Bewerber diesem Zweig die Türe einrennen, dann ist das ein deutliches Signal dafür, dass man sich auch als Universität etwas trauen und etablierte akademische Pfade dort und da verlassen darf.
Linz muss, auch das gehört in ein „Mission-Statement“, als breit aufgestellte Hochschule gesellschaftliche Veränderungen aus einer 360- Grad-Perspektive beurteilen. Zum Beispiel die Künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Folgen, die sich aus technischer, juristischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht betrachten lassen. Wenn nur die JKU das kann, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das sich verkaufen lässt.
Linz kann aus seiner Kleinheit eine Stärke machen, dann nämlich, wenn es diese mit Tempo und Flexibilität kombiniert. Im digitalen Zeitalter gelten neue Gesetzmäßigkeiten: Geschwindigkeit kommt vor Perfektion, Wendigkeit vor Größe. Doch wie steht es um diese Tempofestigkeit, wenn es zwei Jahre dauert, bis die Berufung eines neuen Professors durch alle Instanzen gegangen ist? Hier und nicht nur hier werden die Fesseln eines universitären Regelwerks spürbar, das einen Kontrapunkt zur Geschwindigkeit darstellt, mit der sich die Welt draußen ändert.
Die Universität braucht damit mehr Handlungsspielraum und Autonomie, mehr Berufungen von außen, mehr Wettbewerb. Entscheidungsfreude und Engagement dürfen sich nicht „im System“ verlaufen. Nach 50 Jahren nehmen die Dinge Gestalt an. Die Linzer Universität ist nicht für das Kleine geboren. Sie muss ihre Spannkraft entdecken, größer denken und über den Horizont der Bewahrer hinaus. Unsicherheit als Ordnungsprinzip gehört dazu.
Die blaue Ökologie
Warum der Ökologismus allen Unkenrufen zum Trotz unsere Zukunft bestimmen wird. Ein Essay von Zukunftsforscher MATTHIAS HORX.


Verantwortung nicht delegieren
Der Soziologe HARALD WELZER über den viel umkämpften Begriff der Verantwortung und den Beitrag, den eine Universität in der Gesellschaft leisten muss.
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite