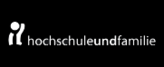„Die jungen Leute schauen nicht mehr zu“
Vor acht Jahren sprach Oliver Welter, den man als Kopf der wegweisenden österreichischen Band „Naked Lunch“ kennt, in einem Interview noch davon, bezüglich der Gesamtsituation nicht besonders optimistisch zu sein. Auch wenn Welter als gelernter Pessimist mit vielem, was er in der Gesellschaft beobachtet, hadert, hat sich sein Blick auf die Zukunft doch drastisch geändert. Die junge Generation und vor allem die aktivistischen Frauen geben ihm Hoffnung. Ihnen traut er zu, das Ruder in Klimabelangen noch einmal herumzureißen. Welter, der bei der Eröffnung des Ars Electronica Festivals am 8. September am JKU Campus mit der Pianistin Clara Frühstück Schuberts „Winterreise“ neu interpretieren wird, über große Visionen, unbelehrbare Männer und den Wunsch von einem Zusammenleben im Sinne des Humanismus.
Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Woraus besteht alles? Also das Leben, das Universum und der Rest? Im alten Griechenland glaubte man, alles, das existiert, setzt sich aus kleinen, unteilbaren Grundbausteinen, den Atomen, zusammen. Heute weiß man: Auch Atome besitzen einen Kern und eine Hülle, Protonen und Neutronen, die wiederum aus Quarks bestehen … Alles nicht so einfach, mit dem Leben und dem Universum. Das weiß auch Richard Küng, Assistenzprofessor für Quanteninformatik an der JKU. Zu erklären, was er den ganzen Tag macht, ist genauso kompliziert, wie ein Atom zu zerlegen: Wenn man glaubt, man hat die einzelnen Bestandteile verstanden, findet man doch ein weiteres Elementarteilchen.
„Drei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.“ – Für Küng müsste Goethes berühmtes Faust-Zitat abgewandelt werden, denn er ist gleichzeitig Informatiker, Physiker und Mathematiker. Seine Arbeit teilt sich nicht in verschiedene Disziplinen auf, sondern passiert in dem Spannungsfeld zwischen ihnen: Er beschäftigt sich mit Quantenalgorithmen. Und das ist wirklich eine komplexe Sache. Herkömmliche Computer arbeiten mit einem Dualsystem. Entweder es fließt Strom oder es fließt kein Strom. Ein Wert ist 0 oder 1. Die Quantentheorie aber, wie sie etwa bei Quantencomputern zum Einsatz kommt, beschreibt keine vordefinierten Zustände. Das Ergebnis kann 0 oder 1 sein, X oder Y. Die Werte werden erst fixiert, wenn sie gemessen werden. Alles, was wir davor über sie wissen und berechnen können, sind Wahrscheinlichkeiten. Das ist für Richard Küng ziemlich aufregend – weil das die Welt viel komplexer und weniger vorhersehbar macht, aber in diesen Zwischenräumen auch Spannendes passieren kann. „Quantencomputer sind nicht die nächste Generation an Computern. Sie sind ein anderer, zukunftsweisender Weg, um riesige Simulationen durchzuführen – oder Simulationen extrem kleiner Systeme. Es ist mir wichtig, nicht nur über die Entwicklung von Technologien nachzudenken, sondern auch darüber, wie sie eingesetzt werden und allen einen Vorteil bringen kann.“ Gerade deshalb ist Richard Küng nicht nur ein Wissenschaftler, der vom Großen träumt und dabei bis ins Kleinste denkt. Er ist auch ein Weltverbesserer, der weiß, dass es manchmal keine klaren Antworten gibt und dass das wirklich Aufregende vielleicht genau zwischen 0 und 1 passiert.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal spricht Richard Küng, Assistenzprofessor für Quanteninformatik, über seine Arbeit am Quantencomputer und das Spannende an Wahrscheinlichkeiten.


Somnium - Der Traum von Wissenschaft
Von 1993 bis 2002 haben Dana Scully und Fox Mulder die Wahrheit da draußen gesucht: „The Truth is out there“, hieß es. Seit 2010 sucht Martina Seidl, Professorin für Künstliche Intelligenz an der Johannes Kepler Universität Linz, ebenfalls nach der Wahrheit. Oder vielmehr nach dem, was wahr und was falsch ist. „Meine Forschung beschäftigt sich mit der schnellen Auswertung von logischen Formeln. Mit diesen Formeln kann man Regeln ausdrücken, die eine Künstliche Intelligenz befolgen muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen“, erklärt Martina Seidl, womit sie sich den ganzen Tag und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit so beschäftigt. Nicht selten kommt sie sich dabei wie die beiden Akte-X-Agenten vor.
Denn das Denken um Ecken und das Lösen hochkomplexer Aufgaben sind die Herausforderungen, die sie seit Jahren begleiten. „Eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die Korrektheit von Solvern, also den Programmen, welche logische Formeln auswerten. Wenn ein Solver dazu verwendet wird, um zu verifizieren, ob ein anderes Programm korrekt ist, muss man sich darauf verlassen können, dass dieser selbst korrekt ist. Allerdings ist ein Solver meist so komplex, dass dieser selbst nicht verifiziert werden kann, und daher muss man sich andere Verfahren überlegen, um sicher zu sein, dass das gefundene Resultat stimmt. Konkret setze ich hierzu Techniken aus der Beweistheorie ein.“ Wahr, richtig, bewiesen. Es sind große Worte, die die Forschung und das Arbeiten von Martina Seidl prägen. Aber so wie der Mensch die Arbeit prägt, so prägt die Arbeit auch den Menschen. Rätsel und Herausforderungen gibt es im Leben der jungen Professorin genug. Vor allem, seit ihre neun Monate alte Tochter immer wieder die Wahrheit und die Richtigkeit der elterlichen Vorstellungen auf harte Proben stellt. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen hält sich Martina Seidl aber nicht so sehr an X-Akten, sondern lieber an einen anderen Detektiv – an jenen Mann, der in anderen Bereichen eine neue Form der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung erdacht hat. Eines der bekanntesten Zitate, das Sir Arthur Conan Doyle seiner Figur Sherlock Holmes in den Mund gelegt hat, lautet nämlich: „Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.“
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal schreibt Martina Seidl, Professorin für Künstliche Intelligenz, über das Denken um Ecken und das Lösen von komplexen Aufgaben.
Die zärtliche Welt
Ein Essay von VALERIE FRITSCH. Vorgetragen im Rahmen der langen Nacht der Utopie an der JKU.


Weniger Feuerwerke, mehr Sonnenaufgänge
„Das Publikum muss hingenommen werden, wie jedes andere Element.“ Dieser Fatalismus von Friedrich Hebbel (1813–1863) hat kein Ablaufdatum.
Musizieren, lieben und Maul halten
Musik mit naturwissenschaftlichen Verfahren zu betrachten, sei ungefähr so, wie eine Beethoven- Symphonie als Luftdruckkurve darzustellen.
Dieses Zitat wird jenem Physiker in die Schuhe geschoben, der selbst ein Popstar war und von dem man weiß, dass er Ludwig van Beethovens Musik als „emotional zu durchwühlt“ sowie „zu dramatisch und zu persönlich“ empfand. Musik und physikalische Gesetze? Nicht mit Albert Einstein. Für Bach und Mozart schwärmte der Mann, bei dem man romantische Verklärung für Notationen gar nicht erwägen mag, obwohl er seine Geige zärtlich „Lina“ nannte und zu Schuberts Kompositionen bemerkte: „Musizieren, lieben – und Maul halten!“ Dass ihn sogar die Eitelkeit beim Spiel vor Publikum beflog, spürte dereinst der Komödiendichter Ferenc Molnár, als dieser über Einsteins musikalischen Auftritt in kleiner Runde gekichert haben soll. „Warum lachen Sie, Molnár? Ich lache auch nicht in Ihren Lustspielen“, meckerte der Weltweise.
Aber Einstein blieb dran und kramte bei Wohltätigkeitsveranstaltungen so häufig wie ungefragt die „Lina“ aus der Tasche, bis ein Dahergelaufener reklamierte, es werde bald Fritz Kreisler an Einsteins Stelle die physikalischen Vorlesungen übernehmen müssen. Dieser Kreisler war es, der dem Formelvater von E = mc² an einem anderen Abend unterstellte, er könne nicht zählen, als Einstein wieder einmal den Einsatz verpatzt hatte.
So sehr es Einstein auch abstritt, Musik und Mathematik sind Geschwister. Das braucht man einem Mann wie dem talentierten Pianisten, Wittgenstein- Preisträger und JKU-Professor Gerhard Widmer nicht zu erzählen.
Wie einer seiner ehemaligen Informatikstudenten berichtet, weist Widmer diese Verwandtschaft anhand von absichtlich falschen Akkorden auch gerne selbst am Klavier nach. Hatte also Gottfried Wilhelm Leibniz recht, wenn er sagte, Musik sei die versteckte arithmetische Tätigkeit der Seele, die sich nicht dessen bewusst ist, dass sie rechnet? Stimmt das wirklich, wobei doch Musik und Mathematik aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen? Und die Gefahr, dass sie einander begegnen, so groß ist, wie das Risiko, dass sich das Pianisten-Wunderkind Kit Armstrong an einer falschen Taste vergreift.
Musik ist Kunst, die Emotionen auf metaphysische Weise auszudrücken vermag, aber in den Wolken belässt.
Mathematik will Phänomene der Natur nachweisen und in strenge Zahlen gießen, deren Interpretationspotenzial gegen null geht.
Bei Kit Armstrong sei nachgereicht, dass der 28-Jährige außerdem Mathematiker ist, sein naturwissenschaftliches Studium hatte er mit 15 abgeschlossen, parallel dazu ging er bei Alfred Brendel in die Pianisten- Lehre. Komponist Pierre Boulez war ebenfalls Mathematiker, genauso wie Dirigent Lorin Maazel und der revoltierende DDR-Liedermacher Wolf Biermann einer ist. Der Tenor Jonas Kaufmann gilt gerade noch, obwohl er das Mathematik-Studium abgebrochen hat, und Queen-Gitarrist Brian May lassen wir als Doktor der Astrophysik auch noch als einen jener Musiker durchgehen, die rechnerisch auf die Pauke hauen.
Wie kommt es zu dieser Wechselwirkung, zu diesem gegenseitigen Befeuern der einander vermeintlich abstoßenden Pole von Mathematik und Musik?
„Beim Kunstwerk soll das Chaos durch den Flor der Ordnung schimmern“, hat Novalis notiert. Der Flor der Ordnung ist die Kontrollinstanz, ob Musik als Kunstwerk gelten darf, selbst wenn alles mit Gefühl beginnt und mit Gefühl endet. Derlei geformte, mathematischen Prinzipien folgende Musik wird noch in 200 Jahren zu hören sein. Alles andere ist Geräusch und verschwindet.
Zu den vielen Idealen, die sich durch Musik vermitteln, gehört auch das der glücklichen Kommunikation. Man könnte wünschen, dass sich Redende so präzise verstehen, so genau aufeinander reagieren, wie es Musikinstrumente eines Ensembles tun. Der kleine Funke führt zur Explosion, wenn sich Musiker wie Liebende verhalten, indem sie sich aufgeben und Individualität auf der höchsten Stufe im Gemeinsamen praktizieren.
Nimmt man Musik ernst, also auch persönlich, dann kann sie sich zum Soundtrack eines Lebens verdichten, der auch als Formeln einer Identität nachzurechnen ist. Auf Strukturen und Grundrechnungsarten basierend, schafft es aber bloß die Musik, ein größeres Publikum zu verführen, Ergebnisse hörbar, erlebbar zu machen.
Der Mathematiker mag seine Lösungen komplexester Fragestellungen noch so dramaturgisch ausgefeilt vortragen, im Linzer Musiktheater wird man ihm dafür nicht den Großen Saal aufsperren müssen, um die Zuhörerschaft in Sitzreihen zu schlichten.
Also kehren wir wieder bei Einstein ein, der kein einsamer Rechner war. In seinem 1937 veröffentlichten Text „Moralischer Verfall“ beschwört er Künste und Wissenschaften als Zweige desselben Baumes. All diese Bestrebungen zielen darauf hin, „das menschliche Leben zu veredeln, es emporzuheben aus der Sphäre der rein leiblichen Existenz und den Einzelnen in die Freiheit zu führen“.
Und weil die Kunst genauso weit von der Erkenntnis entfernt ist wie die Naturwissenschaft, bringt das Geigenspiel den Physiker in seiner Arbeit keinen einzigen Schritt weiter. Gerhard Widmer ist kein famoser Informatiker, weil er die Klänge des Klaviers zu dressieren versteht. Wie viele naturwissenschaftlich Hochbegabte vertont er ob der systemischen Verwandtschaft die Varietäten seiner Anlage. Nur klingt sein Talent einerseits wunderschön – und andererseits? Gar nicht. Doch der Baum ist derselbe.


Kultur zieht an
Der Kepler Salon ist in Oberösterreich zu einem Fixstern der Wissensvermittlung geworden. Jetzt verbindet sich die Kulturinstitution mit der Johannes Kepler Universität Linz. Und das nicht nur des gemeinsamen Namenspatrons wegen.
Symphonie in Bit-Dur
Wie passen Orchesterwerke und künstliche Intelligenz zusammen? Der JKU-Informatiker Gerhard Widmer analysiert mithilfe ausgeklügelter Technologien die Musikwahrnehmung. Und dringt dabei zum Kern künstlerischen Ausdrucks vor.


Tanz die Lichtwellendellen
Der JKU-Mathematiker Günter Auzinger ist Österreichs bester Science Slammer – und fährt im Juli zur Europameisterschaft nach Frankreich.
Science oder Fiction?
Videotelefonie, selbstschnürende Turnschuhe, Weltraumtourismus: Die Popkultur bedient sich häuig der Wissenschaft und eröfnet dieser umgekehrt oft neue Pfade. Dies gilt vor allem für das Genre der Science-Fiction, deren Autoren seit jeher dieselbe Inspirationsquelle für ihre Groschenhefte wie Forscher und Erfinder verwenden – ihre Fantasie.
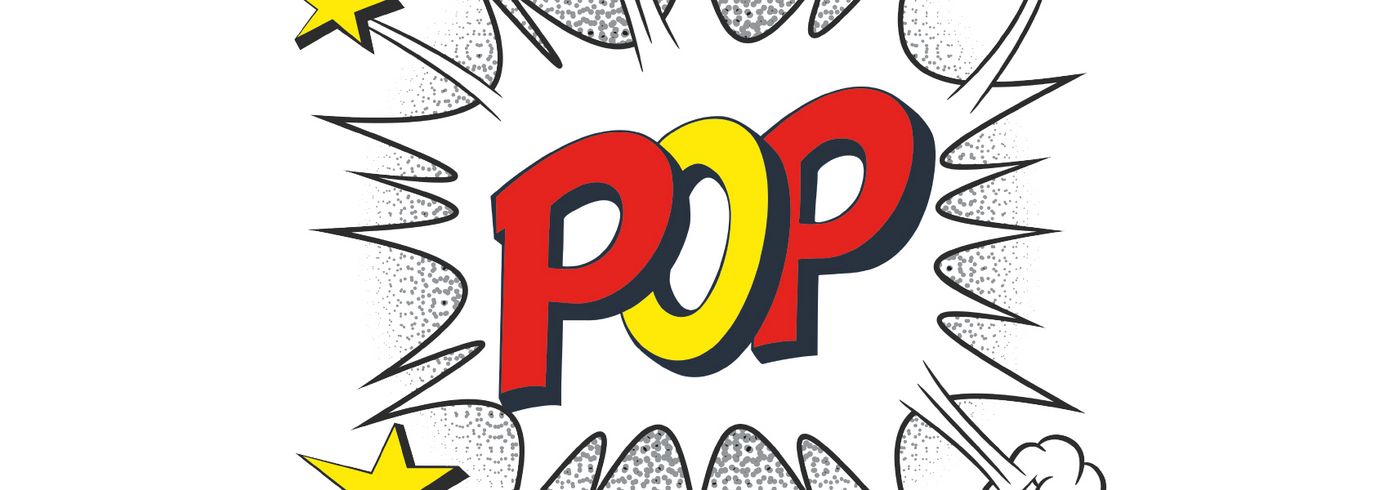

Der Countdown zur Rettung der Welt
Die Dokumentation „Guardians of the Earth“ zeigt die schwierigen Verhandlungen auf der Klimakonferenz von Paris 2015. Elke Schüßler, Vorständin des Instituts für Organisation der JKU Linz, erforscht, wie Entscheidungen auf Klimakonferenzen zustande kommen. Ein Gespräch über den mühsamen Weg zum Konsens von 195 Staaten und auch darüber, was der Film nicht zeigt.
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite