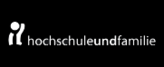In Christian Doppler Labors wird anwendungsorientierte Grundlagenforschung betrieben.

Das geschieht mit Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und einem oder mehreren Unternehmenspartner*innen. Nun ist das CD-Labor „Digitally Assisted RF Transceivers for Future Mobile Communications“ an der Johannes Kepler Universität Linz abgeschlossen – und zieht ein sehr positives Resümee.
Konkret hat sich die Forschungsgruppe um die beiden CD-Labor-Leiter Univ.-Prof. Dr. Mario Huemer (Institut für Signalverarbeitung) und Univ.-Prof. Dr. Andreas Springer (Institut für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme) mit der Frage beschäftigt, wie mit Methoden der digitalen Signalverarbeitung die Leistungsfähigkeit von Mobilfunkchips in Smartphones gesteigert werden könnte – und das bei gleichzeitig verringertem Stromverbrauch dieser Chips. Die Antwort: Neue Methoden, der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz und neue Chiparchitekturen.
Von 4G zu 6G
Dabei war nicht sicher, ob das CD-Labor überhaupt über die gesamte Laufzeit von 8 Jahren aktiv sein würde – 2019 verkaufte Intel die Mobilfunk-Sparte. Damit stieg der damalige Unternehmenspartner, ein Tochterunternehmen von Intel, aus dem Labor aus. „Da herrschte einige Monate große Unsicherheit“, so Prof. Huemer. Zum Glück zeigte Apple großes Interesse am Know-how der JKU und übernahm das Projekt sowie die Teilfinanzierung des CD-Labors. Auch eine andere Änderung gab es: „Wir begannen mit Forschung an 4G und 5G“, erzählt Prof. Springer. Doch die Technik entwickelte sich weiter: Am Ende experimentierten die JKU Forscher*innen bereits mit Konzepten für 6G.
Kleiner Chip, große Wirkung
Woran nun eigentlich? „Im Endeffekt geht es um einen Teil von Handys, der Hochfrequenztransceiver heißt“, erläutert Springer. Das Teil ist nur rund 8*8 mm klein, enthält aber Sende- und Empfangsmodule des Handys, ohne die weder Internetverbindung noch Telefonieren möglich wäre. Dieser Chip muss zuverlässig arbeiten und soll wenig Strom verbrauchen, beides Themen die im CD-Labor adressiert wurden. "Neben klassischen, sogenannten statistischen Signalverarbeitungsmethoden, wurden dabei auch Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt. Die Arbeit an dieser sehr anwendungsorientierten Aufgabenstellung hat aber auch grundlegende Forschungsarbeiten angestoßen“, erklärt Prof. Huemer, Leiter des CD-Labors.
Zudem wurden auch Machine-Learning-Routinen für den kleinen Chip entwickelt – ein durch die winzigen Dimensionen besonders herausforderndes Vorhaben. Zudem sollen Transceiver der Zukunft nicht mehr nur Telefon- und Internetverbindungen ermöglichen, sondern auch die Umgebungsbedingungen erfassen und so die Qualität der Datenübertragung weiter optimieren.
Beeindruckender Output
Mehr als 25 Wissenschaftler*innen arbeiteten in den Spitzenzeiten im CD-Labor, das nun nach acht Jahren abgeschlossen ist und mit einem Budget von etwa vier Millionen Euro dotiert war. Und das äußerst erfolgreich: 70 Publikationen sind entstanden – und gleich neun Patente wurden angemeldet. Außerdem konnten 13 Dissertationen und vier Masterarbeiten abgeschlossen werden. „Eine ganze Menge unserer Mitarbeiter*innen wurden dann direkt von Apple übernommen“, freuen sich die beiden CD-Labor-Leiter.